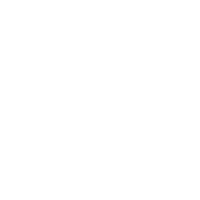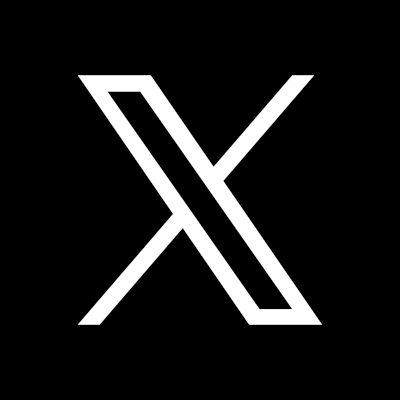- GU Home
- FB03 Gesellschaftswissenschaften
- Institute
- Soziologie
- Institutsnews
Institutsnews – Februar 2021
Folgen des Klimawandels und Wassermangels im Biosphärenreservat Rhön
Forschungsprojekt KlimaRhön
Die Wasserressourcen für die Ökosysteme und die Bürger*innen managen – und das nachhaltig und angepasst an die Folgen des Klimawandels: Hierfür sollen im länderübergreifenden Forschungsprojekt „KlimaRhön“ Wege aufgezeigt werden. Welche Probleme das in der Rhön mit sich bringt, darüber haben sich die Projektverantwortlichen in einer digitalen Kick-off-Veranstaltung mit zahlreichen Akteuren aus dem UNESCO-Biosphärenreservat Rhön ausgetauscht. In den kommenden zwei Jahren werden mehrere Workshops angeboten, auf deren Grundlage Handlungsempfehlungen zu Anpassungen an den Klimawandel erarbeitet werden sollen. Die Verwaltungen des Biosphärenreservats hoffen auf eine rege Beteiligung der unterschiedlichen Akteure.
 |
| Die Folgen des Klimawandels machen sich längst auch im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön bemerkbar – wie im Schwarzen Moor, das unter den extremen Hitze- und Trockenperioden der vergangenen Sommer gelitten hat. / Foto: Alana Steinbauer |
Das transdisziplinäre Forschungsprojekt, das die Goethe-Universität Frankfurt am Main in enger Kooperation mit den drei Verwaltungen des UNSECO-Biosphärenreservats Rhön in Bayern, Hessen und Thüringen durchführt, läuft bis 2022 und wird vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) finanziert. Ziele sind die gemeinsame Risikobewertung hinsichtlich der klimabedingten Einschränkung der künftigen Wasserverfügbarkeit und die Erarbeitung von Anpassungsstrategien unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen. Denn: Landwirtschaft, Industrie, Tourismus, Privathaushalte – die Folgen des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit und die -qualität werden langfristig alle Bereiche des (öffentlichen) Lebens und Arbeitens beeinflussen.
Ein erster Schritt im Projekt war eine länderübergreifende Umfrage, zu der die Goethe-Universität im Sommer 2020 aufgerufen hatte. Darin ging es in der Hauptsache darum, wie die Folgen des Klimawandels hinsichtlich Wasserverfügbarkeit und -qualität bereits heute wahrgenommen werden, welche Ängste mit Blick auf die Zukunft bestehen und wie groß die Bereitschaft hinsichtlich Anpassungsmaßnahmen ist. An der Umfrage beteiligten sich rund 350 Rhöner Bürger*innen aus unterschiedlichen Interessensgruppen, darunter Land- und Forstwirtschaft, Natur- und Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft, Politik, Bildung und Tourismus.
Großteil bemerkt Einschränkungen bereits jetzt
Die Ergebnisse aus der Umfrage und Hintergründe zum Projekt stellten die Professorinnen Dr. Birgit Blättel-Mink und Dr. Petra Döll sowie die beiden Forschenden Laura Müller und Max Czymai aus natur- und sozialwissenschaftlicher Perspektive vor. Aus naturwissenschaftlicher Perspektive wurde gezeigt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft im Sommer weniger Niederschlag fallen und weniger Grundwasser gebildet werden könne. Bei der Darstellung wurde aber auch verdeutlicht, wie unsicher solche Abschätzungen für die Zukunft sind. Entscheidungen im Wassermanagement müssen also unter Unsicherheit getroffen werden. Bei der Umfrage wurde deutlich, dass bereits jetzt ein Großteil der Befragten eine Einschränkung der Wasserverfügbarkeit bemerke. In welchem Maße dieses Problem wahrgenommen und wie die zukünftige Bedrohung eingeschätzt wird, werde unter anderem vom Wohnort und der Berufs- beziehungsweise der Interessensgruppe der Befragten beeinflusst.
In der Wahrnehmung der Befragten habe die Wasserverfügbarkeit in den vergangenen drei Jahren in Thüringen am stärksten abgenommen. Den Befragten zufolge seien die Bereiche Land- und Forstwirtschaft, Natur- und Artenschutz sowie Gewässer- und Hochwasserschutz besonders stark vom Klimawandel betroffen. Perioden mit Bodentrockenheit und die Austrocknung von Flüssen, Bächen und Seen werden als besonders problematische Folgen der Klimaänderungen beurteilt und können mit einer Wasserknappheit einhergehen. Neben den Klimaänderungen werden seitens der Befragten insbesondere Privathaushalte und die Landwirtschaft für die wahrgenommene Abnahme der Wasserverfügbarkeit verantwortlich gemacht.
Mehrere Workshops geplant
„Mit Blick auf die Einwohnerzahl von 220.000 Menschen im Biosphärenreservat ist die Umfrage zwar nicht repräsentativ. Trotzdem sind die Ergebnisse robust genug, um weiter darauf aufzubauen“, erklärte Ulrike Schade, Leiterin der Thüringer Verwaltung. Anschließend diskutierten die rund 40 Teilnehmenden zu folgenden Fragen: Auf welche zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels, die nur unsicher abgeschätzt werden können, wollen wir uns einstellen? Was sind in den verschiedenen Anpassungsfeldern geeignete Anpassungsmaßnahmen? Auf welche Konflikte und Hindernisse könnten wir bei der Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen treffen? Darauf aufbauend wurde eine Priorisierung der Anpassungsfelder im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorgenommen.
Folgende Workshops sind in Zukunft geplant: „Szenarienentwicklung“, „Bayes’sches Netz (BN)“, „Mögliche Handlungsoptionen und Hindernisse identifizieren“, „Konkrete Anpassungsmaßnahmen entwickeln“ sowie „Handlungsempfehlungen auf Basis von BN, Stakeholder*innen-Expertise sowie Fokusgruppen und Evaluation“.
Mehr Informationen zum Forschungsprojekt
Die Pressemitteilung erschien erstmals am 17.02.2021 auf der Website des Biosphärenreservats Rhön.
Netzwerkforscher Christian Stegbauer über die "Gesellschaft im Zeichen des Virus"
Corona - auch ein Indikator für Ungleichheit
Sozialität im Dazwischen. Netzwerkforscher Christian Stegbauer spricht im neuen UniReport über sein Buch Corona-Netzwerke - Gesellschaft im Zeichen des Virus und den Verlust informeller Kontakte.
UniReport: Herr Professor Stegbauer, viele wissenschaftliche Disziplinen haben sich mittlerweile zur Corona-Pandemie geäußert. Was hat bei Ihnen die Idee reifen lassen, sich als Netzwerkforscher damit zu beschäftigen?
Christian Stegbauer: Als die Idee zu dem Buch entstand, waren es vor allem die Virologie und die Ökonomie, die die Debatte beherrschten. Diese Debatte erschien uns als zu schmal – zumal wir als Netzwerkforscher*innen uns im Zentrum des Geschehens bewegen: Das Virus verbreitet sich entlang der Strukturen sozialer Beziehungen und das ist das, womit sich die Netzwerkforschung beschäftigt. Vor fünf Jahren haben wir die Deutsche Gesellschaft für Netzwerkforschung gegründet. Zahlreiche Disziplinen haben den Wert dieser anderen Perspektive erkannt. Uns interessiert weniger der einzelne Mensch und sein individuelles Verhalten; wir schauen mehr darauf, wie sich Sozialität im Dazwischen, in den Beziehungen herstellt und welche Konsequenzen das hat.
Viren werden durch/bei Begegnungen von Mensch zu Mensch übertragen – stellt die Pandemie damit automatisch die Grundlagen von Mobilität und Globalisierung infrage?
Die Globalisierung der Wirtschaft und der Tourismus hat die Menschen näher zusammengebracht. Mit den Reisenden wandert auch das Virus. Eine mögliche Strategie, die Verbreitung entlang der Reisewege zu verringern, ist die Restriktion von Reisen. Das Zusammenrücken der Welt bedeutet aber auch, dass viele Familienbeziehungen leiden. Das gilt nicht nur für solche Menschen, deren Wurzeln aufgrund der Migration in anderen Ländern liegen. In der Wirtschaft diskutiert man darüber, ob man nicht auf viele Reisen verzichten könne und sich stattdessen auf Videokonferenzen beschränken könne. Diese Idee ist übrigens schon älter und trotzdem führte die Ausweitung von Beziehungen über Ländergrenzen hinweg zu immer mehr Reisen. Gegenseitiges Vertrauen generiert man am besten, wenn man sich trifft und neben dem Business auch persönliche Begegnungen hat. Dabei lernt man die Menschen viel besser kennen und es entstehen gegenseitige Verpflichtungen. Die Pandemie zwingt zu einer Einschränkung der direkten Kontakte und daher ist es wahrscheinlich, dass es danach sehr schnell wieder losgeht mit den Reisen.
In einem Beitrag beschäftigen Sie sich damit, dass das Virus nicht alle gleichmacht, sondern es ein Indikator für Ungleichheit ist. Können Sie das kurz verdeutlichen?
Zu Beginn der Pandemie wurde häufig geäu-ßert, dass das Virus ein Gleichmacher sei, weil sich auch zahlreiche Prominente infiziert hatten. Allerdings kann sich die verhältnismäßig reiche angestellte Mittelschicht in ihr einigermaßen sicheres Homeoffice zurückziehen. Sie hat dadurch mehr Autonomie über die eigenen Kontakte zu bestimmen. Die Arbeiter auf dem Bau, in den Schlachthöfen oder der Landwirtschaft hingegen, werden immer noch häufig in Sammelunterkünften untergebracht oder in engen Fahrzeugen zum Einsatzort gebracht. Diese können nicht über Distanzierung entscheiden – mit wem sie in Kontakt kommen, darüber bestimmen ihre Arbeitgeber. Ähnliches gilt natürlich auch für die im Frühjahr letzten Jahres sogenannten Coronaheld*innen. Diese kommen berufsbedingt mit sehr vielen Menschen in Kontakt. Diese neue Un-gleichheitsdimension könnte man als den Grad der Netzwerkautonomie bezeichnen – inwiefern man selbst über Kontakte und deren Reduzierung bestimmen kann.
Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit dem sogenannten »Hamstern«. Dies wurde im Zuge der Pandemie von den meisten Menschen als hochgradig irrationales und unsoziales Verhalten gegeißelt. Wie sieht die Netzwerkforschung die extreme Bevorratung bestimmter Produkte?
Das Hamstern hat seine Ursache vor allem in der Verunsicherung der Menschen und ihrer Bewältigung. Diese Unsicherheit wurde durch die Medien und Politik verstärkt, obwohl dies nicht intendiert war. Die Medien berichten immer von den Hotspots der Probleme und verstärken so deren Wahrnehmung. Die Politik behauptete zu Beginn der Krise, dass unser Gesundheitssystem bestens auf die Pandemie vorbereitet sei – das stellte sich sehr schnell als falsch heraus. Aus der Aussage, dass Masken nichts nutzten, wurde bis heute die Tragepflicht von FFP2-Masken. Zwar lernt man auch dort hinzu, aber wenn man durchschaut, dass diese Aussagen falsch waren, glaubt man dann den Aussagen, die Versorgung mit Nudeln und Toilettenpapier sei gesichert, wenn die Regale in den Geschäften leer sind? Durch die Kontaktbeschränkungen wurden die Möglichkeiten, sich mit anderen über die Lage zu unterhalten, stark reduziert. Das führte dazu, dass die Verunsicherung noch weiterwuchs, weil es schwer war, sich an der Praxis der anderen zu orientieren. Wo wir das Verhalten der anderen beobachten konnten, das war zum Beispiel in den Läden. Da wurden vor uns die letzten Nudeln herausgetragen. All das sorgte dafür, dass sich die Knappheit vergrößerte. Daraus ergab sich das Bedürfnis, die fehlenden Produkte ebenfalls zu bevorraten, weil die Befürchtung bestand, dass es nächstes Mal ausverkauft sein könnte. Dass dieses Verhalten die Knappheit eigentlich erst erzeugt, ist etwas, was man nur aus einer Makroperspektive analysieren kann. Das ist aber nicht die Verhaltens- und Orientierungsebene des Einzelnen.
Ein Bereich des Buches ist Arbeit, Wirtschaft und Technik gewidmet: Das Homeoffice wird in der Pandemie als Mittel zur Reduktion von Direktkontakten gesehen und darüber hinaus von vielen auch als Mittel der Flexibilisierung der Arbeitskultur geschätzt. Reichen die Kontakte über Telefon, Videochat und Mail, um den Anforderungen an soziales Netzwerken zu genügen?
All die technischen Hilfsmittel, um in Kontakt zu bleiben, sind hilfreich. Allerdings ersetzen sie nicht den persönlichen Umgang miteinander. In der Videokonferenz sieht man beispielsweise die anderen nur als einzelne Kacheln, weiß aber nichts über deren Verhältnis zueinander. Da ist es ganz schwer, Stimmungen abzuschätzen oder bei virulenten Problemen an verschiedene Argumente außerhalb der geplanten formalen Sitzungen heranzukommen. Für Organisationen kann man wohl sagen, dass das, was die eigentliche Organisation ausmacht, die informellen Kontakte, sehr stark leiden. Wir wissen aus der Organisationssoziologie, dass durch das Informelle das offiziell Geplante erst gängig gemacht wird. Insofern kann man sagen, dass die Kommunikation über Medien wohl nicht ausreicht. Unternehmen, die denken, jetzt könne man Büroraum abgeben und die Mitarbeitenden zu Hause lassen, werden die Probleme, die das verursacht, wahrscheinlich auch noch zu spüren bekommen.
Ein Beitrag beschäftigt sich mit den zahlreichen Talkshows im Fernsehen. Inwiefern greift auch hier der Netzwerkansatz, denn schließlich diskutieren hier zum Teil recht prominente (Einzel)Akteure?
In dem Beitrag wird analysiert, wer an welcher Talkshow teilgenommen hat. Dadurch erzeugt man ein sog. bimodales Netzwerk – aus Personen, die in Talkshows waren und den Talkshows selbst. So kann man zum Beispiel schauen, welche Gäste unterschiedliche Sendungen miteinander verbinden, weil sie in verschiedene Talkshows eingeladen wurden. Karl Lauterbach war zum Beispiel derjenige, der in allen Talkshows zu Gast war. Zwar spielt die Telegenität und Schlagfertigkeit bei deren Auswahl der Gäste auch eine Rolle, sie werden aber als Repräsentanten gesellschaftlicher Gruppen (etwa Parteien, Gewerkschaften oder Kirchen) eingeladen. Es kann auch sein, dass sie für gesellschaftliche Systeme stehen, wie für die Wirtschaft, die Gesundheit, die Kultur u. ä. So kann man mithilfe der Netzwerkanalyse zeigen, welche gesellschaftlichen Teilsysteme vorkamen und welche am zentralsten waren. Für die Wissenschaft insgesamt ist das Ergebnis eigentlich sehr gut, denn es kam kaum eine Talkshow ohne Vertreter aus der Wissenschaft aus.
Ihr Buch ist im Frühsommer 2020 entstanden; würden Sie mit Blick auf den weiteren Verlauf der Pandemie und besonders auf den aktuellen »harten« Lockdown andere Aspekte sehen?
Vielleicht kann man sagen, dass aus der Sicht der Netzwerkforschung, für die soziale Kontakte, deren Bedeutung und Struktur im Mittelpunkt steht, der Lockdown nicht hart genug ist. Was wir doch alle erleben, ist das große Bedürfnis, wieder mehr mit anderen Menschen zusammenzutreffen. Der Lockdown nun schneidet die wichtigen Beziehungen gefühlt endlos ab – ohne dass absehbar wäre, wann diese Entbehrung zu Ende ist. Im Gegenteil, eine Verlängerung der Beschränkungen reiht sich an die nächste. Ein kürzerer kompletter Lockdown hingegen würde die Aussicht auf etwas normalere Beziehungen erhöhen. Das wäre ein Preis, für den es sich lohnen würde, sich etwas mehr – aber nicht endlos anzustrengen.
Kann die Netzwerkforschung aus ihren Beobachtungen und Analysen auch Empfehlungen für künftige Krisen dieser Art gewinnen?
Menschen sind so konstituiert, dass sie ohne soziale Kontakte nur schwer leben können. Ihnen fehlt dann nicht nur die Nähe und Zuneigung, ihnen fehlt auch ein großes Ausmaß an dem, was man als soziale Integration bezeichnen könnte. Hierdurch entstehen erst unsere Identitäten, aus denen wir als Menschen unsere Orientierung ableiten können. Das hat aus der Netzwerkperspektive genauso einen hohen Stellenwert wie die Prosperität der Wirtschaft. Das Abschneiden von Kontakten wirkt sich auch auf die Gesundheit aus, die Wirkung geht aber weit darüber hinaus. Man kann sich wünschen, dass solche Aspekte bei der Bekämpfung künftiger Krisen Berücksichtigung finden. Da man sich aneinander orientiert, dürften Vorbilder eine gewisse Rolle spielen. Wenn die anderen Familienmitglieder, die Nachbarn oder die Kolleginnen und Kollegen sich impfen lassen, wird es schwer sein, eine Argumentation dagegen aufrechtzuerhalten. Auch hier sind Kontakte wichtig, weil sie dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Denken Sie, dass die Pandemie zu dauerhaften Veränderungen im Sozialverhalten führen könnte, vor allem bei von Ihnen im Buch als »super schwache Beziehungen« bezeichneten Kontakten auf Volksfesten oder Clubs?
Super schwache Beziehungen finden sich häufig. Sie spielen für die Pandemie dann eine Rolle, wenn einander unbekannte Menschen sich sehr nahekommen. Während wir im Alltag meist nur auf dieselben Personen treffen, wird dieses Schema im Urlaub beispielsweise gebrochen. Wenn sich dort Leute zum Beispiel aus verschiedenen Ländern treffen, dann ist das die Chance für das Virus, sich in Bereiche zu verbreiten, die es sonst nicht erreichen könnte. Wenn es das Virus dann an einen anderen Ort geschafft hat, verbreitet es sich dann allerdings wieder regulär, das heißt innerhalb der regelmäßigen engen Kontakte. Insofern könnte man bei den super schwachen Beziehungen am ehesten Kontaktreduzierungen durchführen, um eine Verbreitung in neue Gebiete zu verhindern. Andererseits ist der enge Kontakt mit Menschen, denen man sonst nicht begegnet, besonders bereichernd. Diese Menschen sind interessant, denn man erfährt Dinge, die einem sonst nicht zugänglich sind. Es mag also es kurz nach Ende der Pandemie noch eine gewisse Skepsis gegenüber solchen Orten geben, aber das dürfte nur von kurzer Dauer sein.
Fragen: Dirk Frank
 |
Stegbauer, Christian, Clemens, Iris (Hg.): CoronaNetzwerke – Gesellschaft im Zeichen des Virus. Wiesbaden, Springer 2020 |
Das Interview erschien im UniReport 1/2021.
Eine Analyse zur Corona-Krise von Katharina Hoppe
Die Freiheit zur Verleugnung - oder: Keine Helden braucht das Land
„Freiheit vor Fürsorge“ – dieser Slogan ließ sich auf einem Schild bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München im Juli 2020 lesen. Die Geste, Freiheit und Fürsorge einander gegenüberzustellen, ruft einen ganzen Katalog herrschaftsförmiger Dualismen auf, die das westliche Denken tief prägen. Dabei handelt es sich um Begriffspaare, in denen die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und feminisierter Arbeit ebenso angelegt ist wie eine Geringschätzung des Reproduktiven, Körperlichen, Verletzlichen. Mit dem Freiheitsbegriff werden eine männlich konnotierte Souveränität und Unabhängigkeit identifiziert, während dem weiblich konnotierten Begriff der Fürsorge Abhängigkeit und Zwang zugeschrieben wird. Eine Seite der Unterscheidung unterliegt dabei der Abwertung: So wird das „Weibliche“, das „Irrationale“ oder das „Primitive“ mit dem Natürlichen identifiziert, das zwar passiviert wird, aber paradoxerweise auch als prinzipiell bedrohlich und relativ unverfügbar gilt und daher zu beherrschen ist. Und zwar zu beherrschen durch das Aktive und Überlegene, das „Männliche“, die „Kultur“, die „Rationalität“ oder die „Technik“. Dieser Logik unterliegt auch das Begriffspaar Freiheit und Notwendigkeit. Notwendigkeit ist darin etwas Abzulehnendes, Bedrohliches, weil es mit Alternativlosigkeit und Zwang in Verbindung gebracht wird. In der Szene der sogenannten Querdenker wird Notwendigkeit identifiziert mit „Fürsorge“, die Freiheit untergräbt, während andersherum Freiheit als Abwesenheit jeglicher Notwendigkeit vorausgesetzt wird.
Die Covid-19-Pandemie hat konkreter und vor allem schneller als es die immer noch zu abstrakt vorgestellte Größe des Klimawandels vermag, die intrinsische Verwiesenheit der Pole Freiheit und Fürsorge (oder Notwendigkeit) spürbar gemacht. Die gegenwärtige Intensität der Krisenerfahrung speist sich nicht zuletzt aus einer Erfahrung substanzieller und nicht unmittelbar regierbarer Abhängigkeit. Das Abhängigkeitsgeflecht, das gegenwärtig spürbar wird, muss als Gefüge verstanden werden, in dem das Biologische und das Soziale nicht voneinander ablösbar sind: Ohne eine wie auch immer geartete Sozialität können Viren sich nicht verbreiten, sie kleben gleichsam an den Bewegungsprofilen ihrer Wirtsorganismen. Daher ist die Beschreibung der Pandemie als biosozialer Prozess sinnvoll. So kann auf die lebenserhaltenden, gleichzeitig natürlichen und kulturellen Bedingungen der Existenz hingewiesen werden. Die ihrerseits dualistische Vorstellung, das Soziale oder das Kulturelle ständen der Natur äußerlich gegenüber, führt das Virus ad absurdum. Die Zoonose ist die psychotische Kehrseite einer Produktions- und Lebensweise, die Lebensräume unterschiedlichster Spezies verkleinert, unbewohnbar macht, Spezies näher aneinanderrücken lässt und dadurch die Verbreitung und Entstehung von Viren begünstigt. Die pandemische Konstellation macht also in aller Deutlichkeit spürbar, dass eine klare Abgrenzung von Natur und Kultur nicht funktioniert – vom „Anderen“, dem Natürlichen, hängen „wir“, hängen die Kultur, die Ökonomie, die Produktion immer schon ab. Die Gegenüberstellung Kultur/Natur kann strukturanalog gelesen werden zu Freiheit/Fürsorge. Natur, Fürsorge und Notwendigkeit werden dabei mit dem „Weiblichen“ in Verbindung gebracht, als bedrohlich empfunden; in der Folge wird eine Rationalität etabliert, die sich gegen diese wendet – gegen Frauen und andere als anders markierte Personen ebenso wie gegen die Vorstellung, selbst auf ‚Natur' oder auf Fürsorge angewiesen zu sein. Die Konfrontation mit der Unverfügbarkeit von Viren, von Natur-Kultur-Gefügen, hat daher massive Abwehrreaktionen hervorgerufen.
Die Pandemieerfahrung ist nun in der Tat eine ungekannte Begegnung mit Prekarität – eine Begegnung, die schwer auszuhalten ist, und zwar besonders dann, wenn die eigene Freiheit als völlig abgekoppelt von sozialen, infrastrukturellen und natürlichen Abhängigkeiten, ja, sogar von Fürsorge konzipiert wird, also als abgelöst vom Notwendigen. Diese Freiheit ist eine Freiheit der Verleugnung von Abhängigkeiten, die unter den Vorzeichen einer Pandemie ungleich mehr betont werden muss. Denn die Verleugnungsleistung wird tatsächlich prekär, wenn sie ob der pandemischen Erfahrung, die die Spürbarkeit der eigenen Abhängigkeiten so deutlich erhöht, kompliziert zu werden droht. Es ist dieses Gefühl einer bedrohten Souveränität und der mit dieser Vorstellung zusammenhängenden falsch verstandenen Freiheit als radikaler Unabhängigkeit, die abgeschlossenen Weltbildern, Nationalismen und auch faschistischen Tendenzen in die Hände spielt.
Während die Pflegekräfte nicht als Fürsorgende für andere, sondern als Held*innen im Kampf gegen das Virus gefeiert wurden – was selbstverständlich keine nennenswerte monetäre oder gesellschaftliche Aufwertung ihrer Tätigkeiten zur Folge hatte –, hat sich ein bemerkenswerter weiterer Heldendiskurs ausgebildet, der frappant jene Gefahr zuspitzt, die in der systematischen Verleugnung, Verachtung und Beherrschung des Reproduktiven und Natürlichen angelegt ist. Wiederum auf einem Demo-Schild, diesmal bei der Querdenker-Demonstration in Stuttgart im Mai 2020, ließ sich lesen: „Lieber stehend sterben als kniend leben!“ Hier wird der Tod – jene Notwendigkeit, die schlichtweg nicht zu verleugnen ist – einer heroischen Souveränitätsfiktion unterstellt. Umberto Eco hat in seinen Arbeiten zum Faschismus den engen Zusammenhang zwischen dem „Kult des Heroismus“ und dem „Kult des Todes“ hervorgehoben: „In jeder Mythologie ist der Held ein Ausnahmewesen, aber in der Ideologie des Ur-Faschismus ist Heroismus die Norm. […] Der urfaschistische Held […] ersehnt den Heldentod, der ihm als die beste Belohnung eines heroischen Lebens gepredigt wird.“ [1] Der so verstandene Held stilisiert seine Auflehnung, die sich gegen fremde Mächte sowie etablierte Autoritäten richtet, als Selbstaufopferung im Widerstandskampf. [2] Deutlich wird dabei, dass er keinen Umgang mit den Notwendigkeiten des Lebens findet und seine Abhängigkeit von Fürsorge ebenso wie die eigene Vulnerabilität verleugnen muss. Ein solcher Heroismus ist zutiefst vergeschlechtlicht – die Freiheit des Helden ist die Freiheit von der Notwendigkeit und hier besonders die vermeintliche Freiheit von Körperlichkeit und Angewiesenheit auf andere. Es handelt sich um einen Heroismus, der alles ‚Weibliche' – vor allem die eigenen bedürftigen Anteile – verleugnen muss und demgegenüber männlich konnotierte Begehrensstrukturen über sich hinaustreibt. Darin wird auch der misogyne Zug dieser Abwertungs- und Verleugnungsmechanismen deutlich. Was die Corona-Krise jedoch sichtbar macht, ist gerade, dass es ein Fehler ist, Freiheit und Notwendigkeit in dieser Weise gegeneinander auszuspielen. Freiheit ist nur unter guten Bedingungen der Fürsorge – vom Zugang zu sauberem Trinkwasser über stützende Nahbeziehungen bis hin zu kostenfreier Gesundheitsversorgung – überhaupt möglich. Ja, womöglich realisiert sich Freiheit allein in sorgenden Abhängigkeitsverhältnissen. Dann wäre sie auch verknüpft mit einer Forderung nach Politiken der Notwendigkeit und der Fürsorge, die die komplexen Ermöglichungsbedingungen eines guten Lebens für alle jenseits einer allein ökonomischen Logik einfordern.
Die völlige Negation eigener Abhängigkeiten und Bedürfnisse im Heroismus der „Querdenker“ ist indes nur die Überspitzung einer weiter verbreiteten gefährlichen Souveränitätsfiktion, in der sich auch Klimawandelleugnende und „Querdenker“ treffen. Die Pandemie und ihre Folgen ebenso wie die Konsequenzen der globalen Erderwärmung können als Erinnerungen an Abhängigkeitsverhältnisse verstanden werden. Sie sind die Erinnerung daran, dass wir mit nicht unmittelbar Präsentem oder auch Abstraktem zu tun haben, also unsere Praktiken mit Ereignissen und Gefährdungen, die weit weg erscheinen, verwoben sind. Etwa werden große Flächen des Amazonasgebietes auch zur Aufrechterhaltung ‚unserer' Lebensform abgeholzt. Wir hängen ab von unzähligen menschlichen und nicht menschlichen Organismen, Entitäten, Strukturen – und das im Guten wie im Schlechten. Diese Komplexität ist eine Zumutung, und dennoch ist die annähernde Vergegenwärtigung der eigenen Abhängigkeiten politisch geboten, wenn wir auch nur einen Bruchteil der sich zuspitzenden Krisen begreifen wollen; ihre Verleugnung hingegen ist der sichere Weg in die Katastrophe. Sticker wie „I love Klimawandel“ auf SUVs demonstrieren diese Verleugnung ganz genauso wie die heldenhafte Inszenierung der Freiheit als Unverwundbarkeit oder des Willens zum Helden(tod). Dabei ist es nur eine spezifische – antiquierte – Vorstellung von Freiheit, die hier bedroht ist: nämlich jene, die diese in radikaler Unabhängigkeit und Souveränität aufgehen lässt. Die Freiheit zur Verleugnung ist blutleer, weil sie keine Bedingtheiten kennt und in ihren Überspitzungen gefährlich ist. Das Virus zwingt demgegenüber dazu, darüber zu debattieren und nachzudenken, wie mit Unverfügbarkeit, Notwendigkeit und unserer „Natur“ – als einer auf andere und anderes angewiesenen – besser umgegangen werden kann. Die Frage, wie mit biosozialen Abhängigkeiten gelebt werden kann, wird ohne Zweifel bleiben und kann sich einen defizitären gesellschaftlichen Umgang mit Notwendigkeit und Abhängigkeit nicht leisten. Die Kosten der Verleugnung von anderen und anderem, die an ‚uns' gebunden sind, sind hoch, nicht nur, weil das Natürlich-Kulturelle zurückschlägt und eben nicht gänzlich kontrollierbar ist, sondern auch, weil das Leben einiger darin einer nekropolitischen Logik unterworfen wird. Das Sterben-Lassen in der Pandemie und an den europäischen Außengrenzen ist auch auf Verdrängungsleistungen und (heroische) Souveränitätsfiktionen angewiesen: Keine Helden braucht das Land, sondern postheroische Transformationen von Abhängigkeitsverhältnissen.
Anmerkungen
| [1] | Umberto Eco, Der ewige Faschismus, München 2020, S. 36. |
| [2] | Vgl. zum Motiv des Widerstands gegen etablierte Autoritäten bei den Corona-Protesten die Ergebnisse der empirischen Studie von Oliver Nachtwey/Robert Schäfer/Nadine Frei, Politische Soziologie der Corona-Proteste, 2020, besonders S. 57. Die Studienergebnisse sind online verfügbar unter: https://osf.io/preprints/socarxiv/zyp3f. |
Dr. Katharina Hoppe ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Soziologie mit dem Schwerpunkt Soziale Ungleichheit des Instituts für Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt.
Der Text erschien erstmals am 27. Januar 2021 im Rahmen der Kolumne This is Tomorrow auf www.textezurkunst.de
KONTAKT
Institut für Soziologie
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften
Goethe-Universität Frankfurt a.M.
Campus Westend – PEG-Gebäude
Theodor-W.-Adorno-Platz 6
60323 Frankfurt am Main
Postadresse:
Institut für Soziologie
Hauspostfach 10
60629 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor
Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty
sutterluety@em.uni-frankfurt.de
Institutsreferent
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity