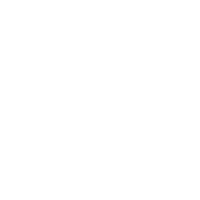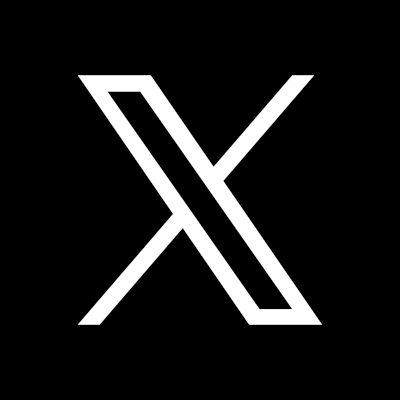- GU Home
- FB03 Gesellschaftswissenschaften
- Institute
- Soziologie
- Institutsnews
Institutsnews – 2021
Ein Interview mit Katharina Hoppe über Angriffe auf Gender-Studies, das verzerrte Bild von der "Cancel-Culture" und die machtvolle Pose der Neutralität
"Forschung passiert nie losgelöst von Machtverhältnissen und auch nicht von Geschlechterverhältnissen"
Als Follow-Up zu ihren Beiträgen in der aktuellen Debatte um Wissenschaftsfreiheit hat Katharina Hoppe in Der Standard ein Interview zur sogenannten Cancel Culture und Machtverhältnissen an Universitäten gegeben.
Der Standard: Die Debatte über eine sogenannte Cancel-Culture an den Universitäten kocht immer wieder hoch: Personen mit unliebsamer Meinung würden von links attackiert, ihre Karrieren ruiniert. Ist das ein realistisches Bild?
Katharina Hoppe: Es gibt mit Sicherheit einzelne Fälle, die man diskutieren sollte. Dennoch schießt die Cancel-Culture-Debatte weit übers Ziel hinaus. Jede Rücktrittsforderung wird skandalisiert, tatsächlich passieren Rücktritte an der Universität in den seltensten Fällen. Im Grunde ist der Begriff der Cancel-Culture zu einem Kampfbegriff mutiert, der stark von rechts vereinnahmt wurde. Es geht darum, eine Bedrohung von links heraufzubeschwören, einzelne Fälle werden tendenziös überdehnt und existierende Machtverhältnisse schlicht ausgeblendet. Wenn eine schwarze Autorin, wie kürzlich Jasmina Kuhnke, ihren Besuch auf der Frankfurter Buchmesse absagt, weil sie sich von der Präsenz klar rechts positionierter Verlage bedroht fühlt, wird dies nicht als Cancel-Culture bezeichnet, sondern schlimmstenfalls als übertriebene Selbstzensur. Außerdem scheint auch niemand auf die Idee zu kommen, die Academics for Peace, die in der Türkei verfolgt und eingesperrt werden, als "gecancelt" zu bezeichnen.
Der Philosoph Konrad Paul Liessmann geht so weit, einen Fall vermeintlicher Cancel-Culture mit Wissenschaftsfeindlichkeit zu vergleichen, wie sie in der Pandemie passiert.
Pandemieleugnung und das Ringen um möglichst gute Wissensproduktion und damit auch um Wahrheit an Universitäten in einen Topf zu werfen, finde ich ein starkes Stück. Das Phänomen taucht aber immer wieder in der Debatte auf: Jede Form der wissenschaftlichen Arbeit, die Ungleichheiten thematisiert – zum Beispiel in der Geschlechterforschung oder auch der Migrationsforschung –, kann als Ideologie gebrandmarkt werden. Was Liessmann letztlich sagt: Die persönliche Betroffenheit hat gewonnen gegen die wissenschaftliche Objektivität. Ich denke, hier handelt es sich auch um einen Abwehrreflex gegen die Infragestellung von bisher sehr einflussreichen, machtvollen Positionen. Herrschaftskritischen Forschungen wird dann schlichtweg die Wissenschaftlichkeit abgesprochen.
Der Vorwurf, Ideologie statt wissenschaftliche Wahrheiten zu produzieren, begleitet die Gender-Studies von Beginn an.
Ja, es ist allerdings nicht so, als würden sich die Gender-Studies nicht selbst über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik verständigen. Es gibt immer schon eine lebendige Debatte darum, wie dieses Verhältnis sinnvoll zu bestimmen ist und wie man sich methodisch ausrichtet, um gesellschaftliche Verhältnisse angemessen darzustellen. Wenn den Gender-Studies Unwissenschaftlichkeit oder ideologische Verblendung vorgeworfen wird, ist es erst einmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass Wissenschaftskritik ein zentraler Bestandteil der Geschlechterforschung ist. Sie hat nichts mit Wissenschaftsfeindlichkeit zu tun, vielmehr hat Wissenschaftskritik in der Philosophie und in den Sozialwissenschaften insgesamt einen hohen Stellenwert. Wir stellen ja immer schon die Frage, was wir überhaupt erkennen können. Wo liegen die Voraussetzungen, die Begrenzungen und Möglichkeiten unseres Erkennens? Historisch betrachtet waren nicht alle Subjektpositionen gleichermaßen an der Wissensproduktion beteiligt. Die feministische und postkoloniale Wissenschaftsforschung hat gezeigt, dass sowohl Frauen als auch rassifizierte Personen lange von der wissenschaftlichen Wissensproduktion ausgeschlossen waren, weil ihnen Spezialinteressen zugeschrieben wurden, die nicht der Allgemeinheit dienen könnten.
Es geht also um Machtverhältnisse in der Forschung?
Forschung passiert nie losgelöst von sozialen Machtverhältnissen und auch nicht von Geschlechterverhältnissen. Jede Wissenschaft ist in historisches Geschehen involviert – und damit auch in irgendeiner Weise positioniert. Eine der wichtigsten politischen Positionen war immer schon die Pose der Neutralität: eine Maske, die behauptet, man hätte mit dem Geschehen rundherum nichts zu tun, man könnte die Welt objektivieren, ohne selbst darin vorzukommen. Die Frage dabei ist, wer eine solche Neutralität behaupten kann – und da ist feministische Kritik ganz zentral. Auch Liessmann fordert ja eine rationale Wissensproduktion in der Tradition der Aufklärung, die keinen Ort, keine Zeit und keinen Körper kennt. Hier werden marginalisierte Perspektiven zu moralischen oder ideologischen Perspektiven, denn sie können es sich nicht leisten, keine Position zu haben, werden als 'gebiast' markiert und ausgeschlossen. Die feministische Wissenschaftskritik legt den Finger in die Wunde – und das tut weh. Denn sie stellt damit die Neutralitätsbehauptung vieler etablierter Professor*innen infrage.
Sie fordern gemeinsam mit Kolleg*innen ein emanzipatorisches Verständnis von Wissenschaftsfreiheit ein – was ist damit gemeint?
Mit einer emanzipatorischen Idee von Wissenschaftsfreiheit wollen wir den Blick stärker auf strukturelle Machtverhältnisse lenken. Die Debatte um Cancel-Culture verkennt, wie die Institution Universität funktioniert. Universitäten sind stark hierarchisch organisiert, das heißt, viele marginalisierte Stimmen finden nach wie vor keinen Eingang in die wissenschaftliche Debatte. Diesen Ausschlüssen versuchen wir uns zu stellen und ihnen entgegenzutreten, wo es möglich und nötig ist. Es geht also darum, sie auch zum Gegenstand der Forschung zu machen, aber auch die Ansprüche auf Partizipation und Repräsentation marginalisierter Gruppen zu verteidigen. Das halte ich für besonders wichtig. Möglichst viele Perspektiven einzubeziehen kann zu einer besseren Darstellung der Welt beitragen – und damit auch zu einer robusteren Objektivität.
Das Interview wurde geführt von Brigitte Theißl und erschien am 16.12.2021 in Der Standard.
Dr. Katharina Hoppe ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Goethe Universität Frankfurt.
Weitere Beiträge zur Debatte um Wissenschaftsfreiheit:
- Machtverhältnisse statt Mythen. Für ein emanzipatorisches Verständnis von Wissenschaftsfreiheit
- Lars Meier (2021): Eine soziologische Unschärferelation. Replik zum Aufsatz "Is Free Speech in Danger on University Campus? Some Preliminary Evidence from a Most Likely Case" von Matthias Revers und Richard Traunmüller. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (2021) 73: 129-135.
- Grenzen der Meinungsfreiheit, Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit? Ein Streitgespräch mit Richard Traunmüller und Thomas Scheffer
Ein Debattenbeitrag von Katharina Hoppe et al.
Machtverhältnisse statt Mythen. Für ein emanzipatorisches Verständnis von Wissenschaftsfreiheit
(Queer-)feministische und anti-rassistische Positionen treffen derzeit auf den Vorwurf, sie würden die Wissenschaftsfreiheit gefährden. Doch dieser vermeintlichen Freiheitsbedrohung liegt eine selektive, politisch motivierte Dramatisierung von Einzelfällen zugrunde, die Machtasymmetrien ausblendet. Ein emanzipatorisches Verständnis von Wissenschaftsfreiheit führt zu einer anderen Lageeinschätzung.
Von Robin Celikates, Katharina Hoppe, Daniel Loick, Martin Nonhoff, Eva von Redecker, Frieder Vogelmann
Seit Monaten geistern Schlagworte wie „Cancel Culture“, „Political Correctness“ und „Wokeism“ durch das deutsche Feuilleton: Die drei Phänomene, so heißt es regelmäßig, würden zunehmend die öffentliche Debatte prägen. Alle drei diskursiven Marker dienen auch dazu, eine Bedrohung der akademischen Wissenschaftsfreiheit von links heraufzubeschwören. Zuletzt hatte insbesondere der Fall der britischen Philosophin Kathleen Stock Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Diese war in Sussex nach Protesten und einer teils gewaltsam entgleisten Social-Media-Kampagne queerer Aktivist:innen gegen die von ihr vertretenen transfeindlichen Positionen von ihrer Professur zurückgetreten. Nur wenige Tage nach ihrem Rücktritt wurde bekannt, dass sie nunmehr als Fellow an die neu gegründete University of Austin berufen wurde, die explizit einen Ort des „Anti-Wokism“ schaffen will.
Gegen diesen Missbrauch von „Wissenschaftsfreiheit“ hielten und halten wir Kritik für dringend geboten. Wir sind ein Autor:innenkollektiv aus Mitgliedern des Frankfurter Arbeitskreises für politische Theorie und Philosophie, einem Zusammenschluss von Geistes- und Sozialwissenschaftler:innen, die sich im Kontext der neueren kritischen Theorie verorten. In dem Beitrag „Wissenschaftsfreiheit, die wir meinen“ (Zeit v. 18.11.2021) hatten wir vor dem oben skizzierten Hintergrund für ein emanzipatorisches Verständnis von Wissenschaftsfreiheit plädiert, das von der selektiven Fokussierung auf und politischen Instrumentalisierung von Einzelfällen Abstand nimmt und besonders auf die Analyse und Infragestellung der universitären Machtverhältnisse abhebt. Die Universität ist historisch ein von Asymmetrien und Ausschlüssen durchzogener Ort, so unser Argument, an dem marginalisierte Stimmen häufig keinen Eingang in den wissenschaftlichen Diskurs finden. Gegen diese Hierarchien zu kämpfen, ist daher ein Eintreten für (wohlverstandene) Wissenschaftsfreiheit, keine Bedrohung derselben.
Ironischerweise sind es weder Vermittlungs- noch Überzeugungsstrategien, mit denen der angeblichen Bedrohung von links begegnet wird. Die reflexartigen Erwiderungen verlassen rasch die sachliche Ebene zugunsten von Unterstellungen und persönlichen Angriffen. Oder sie gehen gleich dazu über, Schweigegebote auszusprechen, wie sie etwa Uwe Steinhoff auf seiner Homepage und auf Twitter an die Adresse von Paula-Irene Villa richtete. Auch unser Beitrag hat wütende Reaktionen hervorgerufen. Die Repliken „Was man nicht kritisieren darf“ von Uwe Steinhoff (FAZ v. 22.11.2021) und „Gezielte Kampagnen“ von Vojin Saša Vukadinović (Zeit v. 25.11.2021) bringen die Debatte auf genau jenes Niveau der Diskussion dramatischer Einzelfälle, auf dem sich sowohl die Wissenschaftsfreiheit als auch ihre tatsächlichen Gefährdungen schnell verzerrt darstellen – und einfacher verzerren lassen. Solche Verzerrungen folgen einem Muster, das drei rhetorische Strategien kombiniert, die im Kampf gegen die vermeintliche „Cancel Culture“ besonders beliebt sind: die Dramatisierung von Einzelfällen, den Vorwurf der Täter-Opfer-Umkehr und die Verbreitung widerlegter Mythen.
Erstens ist es für die anti-woken Verteidiger:innen der Debattenkultur typisch, apodiktisch zu konstatieren, die Wissenschaftsfreiheit sei besonders durch „Transaktivisten oder Gender-Studies-Personal“ gefährdet. Es folgt – z.B. bei Vukadinović – die Aufzählung einer Reihe von Fällen in Großbritannien und die Formulierung des Vorwurfs, die andere Seite erwähne „nichts, was dort in den letzten Jahren eine zentrale Rolle spielte“. Das geht gleich doppelt an der Debatte vorbei: Niemand leugnet die Existenz oder die Relevanz dieser Fälle, doch diese bedürfen einer Einordnung in die universitären und gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Dann jedoch müsste man außerdem eine Reihe von Fällen berücksichtigen, die Vukadinović unterschlägt, weil sie das gängige und von ihm reproduzierte Narrativ in Frage stellen, die akademische Freiheit werde vor allem durch trans- und andere woke social justice warriors gefährdet. Denn er verliert kein Wort zu Lisa Tilley, die im August ihre Stelle am Birkbeck College in London aufgab, um auf die Bedrohung der akademischen Freiheit durch ihren Kollegen, den bekannten Rechtsintellektuellen Eric Kaufmann, aufmerksam zu machen, der gezielt von ihm als links identifizierte Studierende und Kolleg:innen attackiert; kein Wort zu der von Sara Ahmed dokumentierten Tatsache, dass Beschwerden über Machtmissbrauch von Kolleg:innen, Vorgesetzten und Universitätsleitungen oft unter den Teppich gekehrt und unter Androhung von Vergeltung aktiv unterbunden werden, wenn Angehörige von Minderheiten oder in der institutionellen Hierarchie schlechter Gestellte sie äußern; kein Wort dazu, dass (aus Sicht der NGO Liberty und des Joint Committee on Human Rights) die Meinungsfreiheit an den Universitäten in Großbritannien vor allem durch die Prevent Agenda der Regierung gefährdet ist, da besonders BAME (Black, Asian, and minority ethnic) Studierende schnell des Extremismus verdächtigt werden, wenn sie „zu radikale“ Ansichten vertreten, und daher zur Selbstzensur gedrängt werden; kein Wort schließlich dazu, dass auch in Großbritannien, wie in Frankreich und in den USA, regelmäßig insbesondere Forschung zu Rassismus von der Regierung als unwissenschaftlich attackiert wird. Alles nur „projektive Problematisierungen“? Beiträge wie jener von Vukadinović führen genau jene selektive Dramatisierung von Einzelfällen vor, an der die Debatte insgesamt krankt: ein spezieller Fall wird als repräsentativ für die gesamte Lage behauptet, ohne zu untersuchen, welche realen Machtverhältnissen diese Lage bereits strukturieren.
Zweitens läuft auch der Vorwurf der Täter-Opfer-Umkehr ins Leere. Eigentlich sollte es keiner weiteren Erläuterung bedürfen, dass der Hinweis auf die Kritikwürdigkeit einer ganzen Reihe dokumentierter Aussagen von Stock und auf die Einseitigkeit der medialen Berichterstattung über ihren Fall keine Rechtfertigung von Morddrohungen darstellt. Der Kampf „mit allen Mitteln“ ist eine rechte Strategie, die außerhalb der Wissenschaft ganz genauso zu kritisieren ist wie innerhalb. Auch emanzipatorisch angelegter Aktivismus kann in Bedrohungen umschlagen, insbesondere wenn er mit auf Social Media-Plattformen geführten Kampagnen einhergeht. Sachlich formulierte offene Briefe und begründete Proteste sind demgegenüber nicht nur legitime Mittel des Protests, sondern Herzstück demokratischer Willensbildung, und zwar im Kontext des Streits um politische Stellungnahmen – wie diejenigen von Stock in Sachen Rechte von Trans-Personen – auch innerhalb von Universitäten. Diese Strategien mit hate tweets, Einschüchterungsversuchen und gar Morddrohungen in einen Topf zu werfen, ist eine unlautere Strategie, berechtigte Kritik zu delegitimieren.
Differenzierungen sind allerdings nicht die Sache Vukadinovićs, was angesichts seiner früheren Attacken auf das Werk von Judith Butler und „die Gender Studies“ nicht überrascht. Trotz der an anderer Stelle (etwa von Sabine Hark und Judith Butler sowie von Paula-Irene Villa) bereits mit starken Gründen eingeforderten Nuancen schreibt Vukadinović – ebenso wie auch Stock in ihrem Buch Material Girls – weiterhin gegen einen Popanz an: „die Gender Studies“ und ihre „postmoderne“ Leugnung der Realität. Schon die Behauptung, Autor:innen wie Foucault und Butler würden die Realität leugnen, ist absurd; die Fiktion einer einheitlichen Position in „den Gender Studies“ zum Thema Geschlecht und Geschlechteridentität schlicht unwissenschaftlich. Wie vielschichtig und kontrovers die entsprechenden Debatten tatsächlich sind, kann man sich schnell vor Augen führen, wenn man die entsprechenden Zeitschriften (z.B. Feministische Studien oder Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy) und die einschlägigen Beiträge in Online-Enzyklopädien (z.B. https://plato.stanford.edu/entries/feminism-gender/ oder https://plato.stanford.edu/entries/feminism-trans/) konsultiert. Diese für wissenschaftliche Debatten typische Komplexität kommt bei Stock und Vukadinović an keiner Stelle vor. Sie fordern zwar Respekt für ihre vermeintlich rein wissenschaftlichen Einlassungen, lassen aber ein Mindestmaß an wissenschaftlicher Seriosität vermissen und ignorieren willentlich, dass man die relevanten theoretischen Fragen auch diskutieren kann, ohne Menschen die Legitimität ihrer Geschlechtsidentitäten und ihres Anspruchs auf ein Leben ohne Angst vor Gewalt abzusprechen. Das legt nahe, dass es ihnen tatsächlich um etwas anderes geht als einen Beitrag zur akademischen Diskussion: nämlich um die Verunmöglichung von Kritik und die Durchsetzung einer transfeindlichen politischen Agenda unter dem Deckmantel der Wissenschaftsfreiheit (die zudem, immer wenn es strategisch opportun erscheint, mit der Meinungsfreiheit gleichgesetzt wird, obwohl sie klarerweise anderen Standards und Logiken folgt). Damit stellen sie sich selbst in die Nähe derjenigen, die auf ebenso schwacher Grundlage „LGBT-Ideologiefreie Zonen“ fordern und Butler für die Verkörperung des Teufels halten.
Menschenrechtsorganisationen sowie LGBTQ*-Initiativen weisen seit langer Zeit darauf hin, dass Transpersonen gravierenden Anfeindungen und Übergriffen im Alltag, Diskriminierungen im Beruf und Benachteiligungen im öffentlichen Leben ausgesetzt sind. Gestützt werden diese Ausschlüsse, die massives physisches und psychosoziales Leid bewirken, etwa durch Vorurteile, Hassideologien und kulturell dominante Narrative. Diese Erfahrungen – und dies ist die dritte rhetorische Strategie – werden bagatellisiert, wenn Transfeindlichkeit einfach als eine wissenschaftliche „Meinung“ unter anderen dargestellt wird – wie es etwa Uwe Steinhoff tut, der zugleich offen ausspricht, was viele nur denken, nämlich dass vulnerable Personen ohnehin „an einer Universität fehl am Platze“ seien. Vukadinović geht einen Schritt weiter und bedient selbst transfeindliche Vorurteile, indem er empirisch widerlegte Mythen kolportiert, die belegen sollen, dass von trans Personen sowohl als Campus-Aktivist:innen als auch im Alltag eine so große Gefahr ausgehe, dass wir ihre Geschlechtsidentität nicht anerkennen sollten. Nur so ist seine den Anschein empirischer Evidenz erschleichende Behauptung zu verstehen, dass aufgrund der Rechte von trans Personen nun Frauen „noch im Gefängnis Risiko laufen, vergewaltigt zu werden“. Hier wird ein Feindbild beschworen, das Sexualpanik auslösen soll. Die Fantasie geht auf einen einzigen Fall zurück, einen folgenschweren Justizskandal, im Zuge dessen ein wegen Vergewaltigung verurteilter Häftling in ein britisches Frauengefängnis verlegt wurde. (Die gravierende und grassierende sexualisierte Gewalt, der trans Frauen in Männergefängnissen ausgesetzt sind, kommt selbstverständlich nicht zur Sprache). Damit soll die Furcht verbreitet werden, dass unter dem Deckmantel der Transsexualität gewalttätige Männer in Frauenräume eindringen – neben Gefängnissen werden häufig Toiletten genannt. Doch diese Argumentation ist absurd: Nirgends sonst nehmen wir eine ganze Gruppe in Haftung, um der Möglichkeit eines gewaltsamen Übergriffs vorzubeugen. So wird sexualisierte Gewalt überwiegend von Männern in Familien und auf der Straße verübt – trotzdem dürfen Männer Familien haben und vor die Tür. Dass Gewalt aber überwiegend von Männern ausgeht, verweist genau auf die Ebene struktureller Machtverhältnisse. Das Problem geschlechtsspezifischer Gewalt muss durch feministische, gesamtgesellschaftliche Reformen angegangen werden. Sobald der Gegner Patriarchat heißt und nicht „Transgender-Ideologie“ ist es allerdings schwer, Beifall von einer breiten Querfront zu bekommen.
Steinhoffs und Vukadinovićs Texte zeigen wie im Lehrstück, wie unter Bezugnahme auf „Wissenschaftsfreiheit“ asymmetrische Machtverhältnisse verschleiert werden, die Forschung und Lehre durchziehen: Ein rein formaler Begriff von Wissenschaftsfreiheit, der weder nach den zugrundeliegenden Ausschlussverhältnissen noch nach den potenziell gewaltförmigen Konsequenzen von Forschung fragt, reproduziert bestehende Machtverhältnisse – und schließt damit echte Wissenschaftsfreiheit aus. Die Pose der „Neutralität“ ermöglicht es dominanten Gruppen, handfeste politische Interessen als „unvoreingenommene“ oder „rationale“ Forschungsergebnisse zu präsentieren und gleichzeitig marginalisierte politische Interessen als „moralistisch“ oder „ideologisch“ (so Steinhoff) zu disqualifizieren. Selten liegen die politischen Interessen so offen auf der Hand wie bei den deutschen Anhänger:innen von Kathleen Stock, die sich aktuell vor allem gegen die von der Ampel-Koalition geplante Liberalisierung des Personenstandsgesetzes richten (so etwa Steinhoff im rechtskonservativen Magazin Cicero). Häufig geht es um viel subtilere – ökonomische, kulturelle und habituelle – Ausschlüsse. Wer an echter Wissenschaftsfreiheit interessiert ist, muss diese Ungleichheiten angehen: Denn ohne vormals ausgeschlossene Perspektiven einzubeziehen, läuft der wissenschaftliche Diskurs nicht nur Gefahr, soziale Herrschaftsverhältnisse zu reproduzieren, sondern auch die Wissensproduktion künstlich einzuschränken und sich Wege zu einer robusteren Objektivität zu verbauen.
Den Blick auf die strukturelle Ebene zu richten, heißt nicht, bestimmten Gruppen a priori Recht zu geben. Oft heißt es sogar, Gruppenzuschreibungen zu historisieren und zu problematisieren (also Identitätspolitik zu kritisieren). Ebenso wichtig ist es, immer wieder neu danach zu fragen, wo sich auch in ehemals marginalisierten Positionen neue Macht- und Gewaltverhältnisse herausbilden können. Es ist hingegen hochproblematisch von der Gewalt, die Stock entgegenschlug, auf die allgemeinen Verhältnisse kurzzuschließen. Auch wenn jeder Einzelfall zählt, sind Versuche moralischer Panikmache, die sich weder auf die empirische Bedrohungslage noch auf die in der philosophischen Debatte vertretenen Positionen stützen können, Hindernisse für eine ernsthafte Debatte über die Bedrohungen von Wissenschaftsfreiheit. Ein emanzipatorisches Verständnis von Wissenschaftsfreiheit bedarf – und fördert! – klare Machtanalysen, keine weitere Verbreitung von Mythen.
Dr. Katharina Hoppe ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt.
Robin Celikates ist Professor für Sozialphilosophie an der Freien Universität Berlin.
Daniel Loick ist Associate Professor für Politische Philosophie und Sozialphilosophie an der Universität Amsterdam.
Martin Nonhoff unterrichtet Politische Theorie an der Universität Bremen.
Eva von Redecker ist Philosophin und forscht derzeit als Marie-Skłodowska-Curie-Fellow an der Universität Verona.
Frieder Vogelmann lehrt Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie an der Albert Ludwigs-Universität Freiburg.
Der Beitrag erschien erstmals am 08. Dezember bei geschichte der gegenwart.
Weitere Beiträge zur Debatte um Wissenschaftsfreiheit:
- "Forschung passiert nie losgelöst von Machtverhältnissen und auch nicht von Geschlechterverhältnissen." Ein Interview mit Katharina Hoppe über Angriffe auf Gender-Studies, das verzerrte Bild von der "Cancel-Culture" und die machtvolle Pose der Neutralität
- Lars Meier (2021): Eine soziologische Unschärferelation.
Replik zum Aufsatz "Is Free Speech in Danger on University Campus? Some Preliminary Evidence from a Most Likely Case" von Matthias Revers und Richard Traunmüller. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (2021) 73: 129-135. - Grenzen der Meinungsfreiheit, Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit? Ein Streitgespräch mit Richard Traunmüller und Thomas Scheffer
Im UniReport |Nr. 3| 28. Mai 2021 lesen Sie:
Die Rückkehr der "Dinge"
Die Soziolog*innen Katharina Hoppe und Thomas Lemke über ihren Einführungsband
zu den "Neuen Materialismen"
UniReport: Frau Dr. Hoppe, Herr Prof. Lemke, beim Begriff des Materialismus denken viele wahrscheinlich zuerst an eine philosophische Denkrichtung, die prinzipiell vom Primat des Materiellen ausgeht. Was unterscheidet den »Neuen Materialismus«, den Sie in Ihrem Buchvorstellen, aber nun von älteren Denkschulen und -traditionen?
Katharina Hoppe/Thomas Lemke: Die Neuen Materialismen gehen in der Tat von einem solchen
Primat aus. Anders als in „älteren“ materialistischen Traditionen – wie etwa dem
Marxismus – geht es aber nicht so sehr um eine Konzentration auf
gesellschaftliche Verhältnisse im engeren Sinn, wie etwa die Produktionsverhältnisse,
sondern darum, Materie als eine aktive Kraft zu verstehen, die wirkmächtig ist
und die menschliches Leben überhaupt erst ermöglicht. Das bedeutet, die Neuen
Materialismen problematisieren die Vorstellung, Materialität als etwas Passives
aufzufassen, das „wir“ ausbeuten, auf das „wir“ zugreifen, das „einfach so“ da
ist. Reizvoll an einer solchen Perspektive ist, dass die Verhältnisse zwischen
Mensch auf der einen und Natur/Technik auf der anderen Seite weniger als
Gegensatzpaar, sondern als ein Kontinuum in den Blick kommen können. Dann kann
in einem zweiten Schritt untersucht werden, wie die konkreten Grenzziehungen funktionieren,
die Menschen von Nicht-Menschen, Natur von Kultur, Materie von Geist unterscheiden
und mit unterschiedlichen Wertigkeiten versehen. Auf diese Weise zeigen die
Neuen Materialismen, dass unser Verhältnis zur materiellen Welt historisch und
kulturell spezifisch ist – und es auch anders sein könnte.
(Das komplette Interview finden Sie im UniReport |Nr. 3| 28. Mai 2021 auf Seite 9)
"Eine soziologische Unschärferelation"
Lars Meier, Professor für Soziologie der sozialen Ungleichheit an der Goethe-Universität,
hat sich in dem Beitrag „Eine soziologische Unschärferelation“ kritisch mit der Studie
von Richard Traunmüller und Matthias Revers über die Frankfurter Studierenden des
Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften auseinandergesetzt. Traunmüller und Revers
hatten in ihrer Studie, erschienen in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, im Hinblick auf die Umfrageergebnisse festgestellt, „dass sich Studierende häufig sprachlich angegriffen fühlen und dass sich ein beträchtlicher Anteil für die Einschränkung der Meinungsfreiheit ausspricht. Auch finden wir Hinweise für Konformitätsdruck“.
Meier schreibt in seiner Replik, dass der Aufsatz von Revers und Traunmüller Erkenntnisinteresse und Positionalität der durchgeführten Forschung verschleiere. Eine Offenlegung wäre aber notwendig, um die Grundlagen der schwerwiegenden methodischen Probleme, der Fallauswahl und der unbelegten Behauptungen des Aufsatzes verstehen zu können. „Im Widerspruch zu der falschen Annahme, dass Meinungsfreiheit grenzenlos sei und auch mit einer Freiheit einhergehe, andere zu diskriminieren, legt meine Replik die Notwendigkeit […] dar, dass auch an den Universitäten Diskriminierungen aktiv vermieden werden müssen.“
Link zum Artikel: https://link.springer.com/article/10.1007/s11577-021-00736-0
Zum Thema siehe auch das Streitgespräch zwischen Richard Traunmüller und Thomas Scheffer aus dem UniReport |Nr. 6| 17. Dezember 2020.
"Wir könnten Gesellschaft auch anders einrichten"
Der Soziologe Stephan Lessenich über seine neuen Aufgaben an der Goethe-Universität und am Institut für Sozialforschung
UniReport: Herr Lessenich, Sie werden zum 1. Juli Direktor des Instituts für Sozialforschung und zugleich Professor für "Gesellschaftstheorie und Sozialforschung". Freuen Sie sich auf Ihren Start hier?
Stephan Lessenich: Ich freue mich sehr. Gerade diese Konstellation ist eine ganz tolle Sache. Das Direktorat des Hauses allein hätte mich nicht so begeistert. Ich möchte nicht nur im Wissenschaftsmanagement tätig sein, Lehre ist mir wichtig. Und die Denomination der Professur passt zu mir wie die Faust aufs Auge, das ist genau das, was ich mache: Sozialforschung mit gesellschaftstheoretischem Anspruch.
(Das komplette Interview finden Sie im UniReport |Nr. 3| 28. Mai 2021 auf Seite 10)
Goethe-Universität und Institut für Sozialforschung rücken noch enger zusammen
Stephan Lessenich wird Direktor des IfS und Professor in Frankfurt
Die Wartezeit ist vorbei: Der Soziologe Stephan Lessenich, bislang an der Ludwig-Maximilians-Universität in München tätig, wird Professor an der Goethe-Universität und Direktor des renommierten Instituts für Sozialforschung (IfS). Die neu geschaffene Kooperationsprofessur, die mit der Leitungsfunktion am IfS verbunden ist, wurde durch die Bereitstellung von Sondermitteln des Landes Hessen ermöglicht. Universität und Institut rücken auf diese Weise näher zusammen.
FRANKFURT. Im Jahr 2018 hat Prof. Dr. Axel Honneth seinen Abschied als Direktor genommen, seither stand das Institut für Sozialforschung unter der kommissarischen Leitung von Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty, der das Institut zweieinhalb Jahr mit großem Engagement geführt hat. Nun gibt es eine neue Konstellation: Mit Mitteln des Landes Hessen wird eine Professur für „Gesellschaftstheorie und Sozialforschung“ an der Goethe-Universität eingerichtet – eine explizite Kooperationsprofessur mit dem Institut für Sozialforschung. Der erste Stelleninhaber ist nun bekannt: Der Münchner Soziologe Prof. Dr. Stephan Lessenich hat den Ruf nach Frankfurt angenommen und tritt am 1. Juli seinen Dienst an.
„Ich freue mich sehr, dass Stephan Lessenich als Professor und neuer Direktor des IfS nach Frankfurt kommt“, sagt Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn. „Wie relevant die Arbeit des Instituts für Sozialforschung ist, war selten so offensichtlich wir zurzeit. Wir brauchen sie, um die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Das IfS steht in einer philosophischen Tradition, die sich nicht damit begnügt, die Welt verschieden zu interpretieren, sondern sie auch verändern will im Geist des beharrlichen Hinterfragens, der konstruktiven Kritik, der diskursiven Auseinandersetzung. Um diese wichtige Rolle des IfS mit einer hochkarätigen neuen Leitung stärken zu können, haben wir die Förderung des Landes von 2021 an gern von bisher gut 615.000 auf 870.000 Euro pro Jahr erhöht.“
„Für die Goethe-Universität ist es eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass das Institut in der Person von Stephan Lessenich jetzt noch enger an die Universität heranrückt. Professor Lessenich hat sich durch seine Forschung international einen Namen gemacht und wird Universität und IfS weltweit noch stärker sichtbar machen“, sagt Unipräsident Prof. Dr. Enrico Schleiff. „Stephan Lessenich gelingt in idealer Weise die Verbindung von soziologischer Theoriebildung und empirischer Forschung. Ich bin überzeugt, dass die Frankfurter Perspektive in künftigen gesellschaftlichen Debatten eine starke Rolle spielen wird“, kommentiert Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink, Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften, die Berufung. Jutta Ebeling, Vorsitzende des Stiftungsrates des IfS: „Ich freue mich, dass wir das Institut jetzt auf eine neue Grundlage stellen und für die Leitung einen so renommierten Wissenschaftler gewinnen konnten. Herrn Prof. Sutterlüty, der das Institut zweieinhalb Jahre lang mit großem Engagement durch eine schwierige Zeit gesteuert hat, sind wir zu großem Dank verpflichtet“.
„Es ist für mich eine große Ehre, an die Spitze des Hauses berufen zu werden, das auf eine so lange Tradition in der kritischen Gesellschaftstheorie zurückblicken kann. Gerade die soziologische Perspektive ist in diesen Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und gesellschaftspolitischer Weichenstellungen von wachsender Bedeutung“, sagt der künftige IfS-Direktor Prof. Dr. Stephan Lessenich. „Ich möchte das IfS als lebendigen Ort des intellektuellen Austauschs weiterentwickeln. Besonders liegt mir auch die Internationalisierung am Herzen: Die Zukunft der kritischen Sozialforschung kann nicht ohne die Perspektive der globalisierten Welt gedacht werden“, beschreibt Lessenich seine ersten Ideen für das Institut. Auch auf Frankfurt freue er sich schon sehr: „Die Stadt steht für eine politisch-kulturell außerordentlich interessierte Öffentlichkeit, für eine liberale Diskussionskultur und intellektuelle Offenheit.“
Zur Person von Stephan Lessenich
 |
|
Foto: privat |
1965 in Stuttgart geboren, studierte Lessenich von 1983 bis 1989 in Marburg Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte. 1993 wurde er in Bremen promoviert, 2002 erhielt er an der Universität Göttingen die Venia legendi im Fach Soziologie. Seine erste Professur führte ihn an die Universität Jena, wo er Vergleichende Gesellschafts- und Kulturanalyse lehrte und gemeinsam mit Klaus Dörre und Hartmut Rosa die DFG-Kollegforschungsgruppe „Postwachstumsgesellschaften“ initiierte. 2014 wurde Lessenich als Nachfolger von Ulrich Beck auf den Lehrstuhl für Soziale Entwicklungen und Strukturen ans Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität München berufen. Lessenich war von 2013-2017 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, er ist Mitherausgeber diverser wissenschaftlicher Zeitschriften und Buchreihen und u.a. einer der Kuratoriumssprecher und -sprecherinnen des Instituts Solidarische Moderne (ISM). Er bringt sich auch aktiv in gesellschaftliche Prozesse ein, ist beispielsweise Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac und war 2017 Mitbegründer der Partei „mut“, um – wie er sagt – der „Diskursverschiebung nach rechts“ im Gefolge des langen Sommers der Migration etwas entgegenzusetzen.
Wie es zur Neukonzeption gekommen ist
Als „weltweit einmalig“ wurde die am IfS praktizierte „Verbindung von sozialphilosophischer Theoriebildung und empirischer Sozialforschung in der ideengeschichtlichen Tradition der ‚Frankfurter Schule'“ 2015 in einer Pressemitteilung des Wissenschaftsrats zur Evaluation des Instituts genannt. Die wissenschaftlichen Leistungen des Instituts wurden als „sehr gut und in Teilbereichen auch als exzellent“ beurteilt. Zudem werde am Institut eine unverzichtbare „zeitdiagnostische Deutungsarbeit“ für eine breitere Öffentlichkeit geleistet. Allerdings, so hieß es damals, leide „die Forschungsarbeit des Instituts oftmals unter fehlenden strategischen Entwicklungsmöglichkeiten“. „Zentrale Forschungsschwerpunkte“ seien immer wieder in ihrer Existenz bedroht, das Institut sei über Gebühr von Drittmitteln abhängig. Der Wissenschaftsrat empfahl einen robusteren organisatorischen Unterbau sowie ein Netz aus verstetigten Kooperationsbeziehungen. Dafür müsse u.a. das Amt der Direktorin oder des Direktors mit einer grundfinanzierten Planstelle ausgestattet und die Kooperation mit der Goethe-Universität erweitert und formalisiert werden.
In einem aufwendigen Verfahren wurde in Gesprächen mit dem Präsidium der Universität und in enger Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst ein Konzept der engeren Kooperation entwickelt sowie ein neues Modell für die Leitung des IfS. Moderiert wurde dieser Prozess von Jutta Ebeling, der ehemaligen Frankfurter Dezernentin und Bürgermeisterin sowie seit 2018 Vorsitzenden des Stiftungsrats des IfS, die bereits am Zustandekommen der Frankfurter Holocaust-Professur beteiligt war. Nach dem Vorbild dieser Professur in Kooperation mit dem Fritz Bauer Institut sollte eine neue Professur in Kooperation mit dem IfS geschaffen werden. Diese wird jetzt am Institut für Soziologie angesiedelt sein.
In der Vergangenheit wurden Professoren der Goethe-Universität als Direktoren ans IfS berufen und erfüllten diese Aufgabe quasi ehrenamtlich, ohne dass sich dadurch an ihrer Tätigkeit an der Hochschule etwas geändert hätte. Neuerdings ist die jeweilige Professur nur mit 50 Prozent an der Goethe-Uni angesiedelt, mit der anderen Hälfte jedoch am Institut.
Pressemeldungen:
Von außen gesehen. Stephan Lessenich wird Chef des Instituts für Sozialforschung (faz.net)
Zum Institut für Sozialforschung
Das Institut für Sozialforschung (IfS) an der Goethe-Universität ist eng mit den Namen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, aber auch Erich Fromm, Herbert Marcuse oder Leo Löwenthal verbunden. Mit Geldern der Mäzene Hermann und Felix Weil 1923 als Institut des akademischen Marxismus gegründet, wurde das IfS mit Max Horkheimer zur zentralen Forschungsstelle der Kritischen Theorie. Im Frühjahr 1933 wurde das Institut wegen „staatsfeindlicher Bestrebungen“ von der Gestapo aufgelöst. Auf verschlungenen Pfaden gelang es, seinen Sitz an die Columbia Universität in New York zu verlegen und die Arbeit im Exil fortzusetzen. Nach dem Krieg kehrte der engste Kreis des Instituts – Adorno, Horkheimer und Pollock – nach Frankfurt zurück, 1951 wurde das IfS an seinem heutigen Standort wiedererrichtet. Sein Grundhaushalt wird seither durch das Land Hessen und die Stadt Frankfurt gesichert. Im Zuge seiner bald 100-jährigen Geschichte hat das IfS auf vielfältige Weise in Wissenschaft und Gesellschaft gewirkt. Prof. Dr. Axel Honneth, der dem Institut zuletzt vorstand, hat mit seinen Schriften eine normativ gehaltvolle Gesellschaftstheorie der Anerkennung entwickelt.
Der studentische Podcast "Podcasting Populism" gibt die aktuellen Diskussionen über einen umstrittenen Gegenstand wieder
Was genau ist Populismus?
Es gibt ihn von rechts, es gibt ihn von links, aber gibt es ihn auch aus der Mitte der demokratischen Gesellschaft? Vom „Populismus“ ist in diesen Tagen häufig die Rede, aber was genau sich dahinter verbirgt und welche Ausprägungen es gibt, dem wollten Studierende der Goethe-Universität auf den Grund gehen. Die Ergebnisse haben sie in einem sechsteiligen Podcast veröffentlicht.
 |
Wer den Klimawandel leugnet, Migranten die Schuld an Arbeitslosigkeit zuschiebt oder gar an der Grenze auf Frauen und Kinder schießen lassen will, ist nach Meinung vieler Menschen ein Populist. Es gibt populistische Parteien, Bewegungen und Aktionen in den sozialen Netzwerken. Doch was genau macht Populismus aus? Wie wirkt er? Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive ist das alles andere als klar. Im Seminar „Populismus als soziales Phänomen – aktuelle Diskussionen über einen strittigen Gegenstand" haben sich Studierende zusammen mit dem Seminarleiter Dr. Frieder Vogelmann dem Begriff angenähert und dazu einen Podcast produziert.
In sechs Folgen haben sie das Thema aufgefächert und die Teilaspekte in Kleingruppen bearbeitet. Sie haben sich mit Literatur beschäftigt und Interviews mit einschlägig Forschenden geführt. Das Ergebnis ist nachzuhören unter https://anchor.fm/podcasting-populism, wöchentlich wird eine Folge hochgeladen.
Ist der Populismus Sargnagel des demokratischen Zusammenlebens oder ein Korrektiv für in die Jahre gekommene Demokratien? Diese sehr grundsätzliche Frage schwebt über den sechs Beiträgen, in denen es zum Beispiel um das Verhältnis von Populismus und Demokratie, um Populismus auf Social Media, um Abstiegsängste, „Querdenken“ geht. Gesprächspartner in der ersten Folge ist unter anderem Prof. Dr. Dirk Jörke vom Institut für Politikwissenschaft der TU Darmstadt. Die Soziologin und Politikwissenschaftlerin Verena Stern beantwortet in der zweiten Folge Fragen zum Spannungsfeld der Corona-Demos („Zwischen Existenzängsten, Freiheitsideologien und Verschwörungsmythen“) und spricht über ideologische Allianzen und die Handlungsoptionen der Politik.
In der dritten Folge des Podcasts werden Paradoxien des Populismus diskutiert und die Frage erörtert, ob es sich um Tatsachen oder Mythen handelt. Die vierte Folge ist der sozialräumlichen Perspektive gewidmet: Gibt es „Geographien des (Rechts-)Populismus? Folge Nummer fünf beleuchtet das Phänomen, dass die etablierten Parteien während der Corona-Krise an Zustimmung gewonnen haben. Bedeutet das zugleich einen Rückzug des Populismus? Und wie wäre das zu erklären? Populismus ist gewiss kein neues Phänomen, aber wie sieht die moderne Erscheinungsform in Zeiten der Digitalisierung aus? Darum geht es in der sechsten und letzten Folge von Podcasting Populismus: Wie agieren Populistinnen und Populisten in sozialen Medien? Welche Strategien verwenden sie, um ihre Standpunkte unter die Menschen zu bringen?
80 Studentinnen und Studenten haben am Seminar teilgenommen, es gab verschiedene Möglichkeiten des Leistungsnachweises. Unter den 20 Studierenden, die sich dafür entschieden haben, zusätzlich zur Seminararbeit eine Podcastfolge zu produzieren, war auch Edith Schönig, die den Masterstudiengang internationale Beziehungen absolviert. „Die Inhalte in einem Podcast zu erarbeiten, das war sehr kreativ und hat viel Spaß gemacht“, sagt die 24-Jährige. Natürlich habe sie viel über Populismus gelernt – zum Beispiel, dass er nicht zwangsläufig undemokratisch sei –, aber dazu auch noch Gesprächsführung und Schnitttechnik.
Ein Interview mit Ferdinand Sutterlüty
"Rechtspopulismus rechtfertigt seine eigentlichen Beweggründe nicht"
Ferdinand Sutterlüty: Bei den Anhängerinnen und Anhängern rechtspopulistischer Bewegungen und Parteien spielt das Gefühl, betrogen, nicht berücksichtigt und gekränkt worden zu sein, eine große Rolle. Nehmen wir das Beispiel USA: Diejenigen, die von den Folgen der Deindustrialisierung, von Armut, Einkommensverlust und regionaler Strukturschwäche betroffen sind, zeigen eine besondere Empfänglichkeit für die rechtspropagandistische Botschaft, von einer politischen, ökonomischen und kulturellen Elite betrogen zu werden.
Weil auch Vorstellungen weißer Überlegenheit eine Rolle spielen. Wer solche Vorstellungen hat und erlebt, wie Schwarze oder Migranten auf der sozialen Stufenleiter an ihm oder ihr vorbeiziehen, empfindet sich leicht als vernachlässigt und ungerecht behandelt. Diese Leute hat Trump verstanden anzusprechen. Auch hierzulande gibt es bei vielen die Vorstellung, dass die, die schon immer da waren, Vorrechte gegenüber denen haben sollten, die später gekommen sind. Für diese Menschen gibt es politische Angebote, die ihre Wahrnehmungsmuster noch verstärken und in bestimmte Richtungen lenken.
Die meisten sagen nicht direkt, dass sie Vorrechte haben müssen. Oft sagen sie sogar, sie seien für ethnische Gleichheit. Aber wenn zum Beispiel türkischstämmige Unternehmer erfolgreich sind und sozial aufsteigen, suchen sie nach Gründen, warum das nicht sein dürfe. Sie werfen ihnen dann kriminelle Machenschaften vor oder dass sie ganze Stadtteile übernehmen wollten. Das ist ein untergründiges Deutungsmuster, das gar nicht ausdrücklich gerechtfertigt wird, sondern bereits die soziale Wahrnehmung prägt. Aus den USA zeigen Untersuchungen, dass evangelikale Christen oft von solchen Überzeugungen der eigenen Überlegenheit geprägt sind. Sie begreifen sich als „chosen people“. Es ist ein Markenzeichen des Rechtspopulismus, dass er seine eigentlichen Beweggründe nicht rechtfertigt. Es werden ja nicht direkt eine rassistische Politik oder Privilegien gefordert. Man stellt sich als Opfer dar und sagt, es müsse legitim sein, gegen die Verdrängung durch „fremde Völkerschaften“ vorzugehen. Formal werden die Werte des Rechtsstaats verteidigt, aber in den einzelnen Politiken werden diese unterlaufen. Das ist das Besondere am Rechtspopulismus, und deswegen sieht man auch nicht sofort, wie stark er die Grundlagen der Demokratie gefährdet.
Der heute zu beobachtende Rechtspopulismus basiert wesentlich auf Ressentiments, Hass und Zerstörungswut, denn er hat kein positives Gesellschaftsmodell und in diesem Sinne auch keine Zukunft. Man kann da schon von einer libidinösen Besetzung der Zerstörung sprechen: Führungspersonal und Anhängerschaft stimmen darin überein, wenigstens anderen etwas wegzunehmen und kaputtzumachen, was ihnen lieb und teuer ist. Das Schüren von Hass auf bestimmte Gruppen und auf den Staat ist ihr Kerngeschäft. Die Menschen, die das Kapitol in Washington stürmten, versuchten gar nicht erst, etwas Konstruktives in die Politik hineinzubringen, sondern wollten nur Angst verbreiten, und sie attackierten direkt den politischen Gegner. Es werden aber auch die Grundfesten der Demokratie torpediert, wenn demokratischen Verfahren und Institutionen ihre Legitimität abgesprochen wird, weil sie angeblich von dunklen Mächten, Lug und Betrug beherrscht werden.
Offenkundig gibt es viele Menschen, die diese Lust an der Zerstörung, von der Sie sprechen, teilen. Wie soll die Gesellschaft mit diesen Menschen umgehen?
Meiner Auffassung nach müssen wir auch mit Rechten diskutieren, zumindest mit denen, die noch erreichbar sind. Als Demokratin oder Demokrat ist man ja fast dazu verurteilt, daran zu glauben, dass rationale Argumente etwas zählen. Darauf basiert Demokratie. Andererseits ist es ja so, dass der Rechtspopulismus schon auch Ursachen in der sozialen Realität hat. Die westlichen Gesellschaften haben in der Vergangenheit zu viel Ungleichheit zugelassen, und das ist der Nährboden der Deutungsmuster, denen wir im Rechtspopulismus begegnen. Diese mit Ungleichheiten zusammenhängenden Probleme zu adressieren und für sozialen Ausgleich zu sorgen ist und bleibt eine vorrangige Aufgabe der Politik.
Das Interview erschien erstmals am 04.03.2021 auf www.indeon.de
Folgen des Klimawandels und Wassermangels im Biosphärenreservat Rhön
Forschungsprojekt KlimaRhön
Die Wasserressourcen für die Ökosysteme und die Bürger*innen managen – und das nachhaltig und angepasst an die Folgen des Klimawandels: Hierfür sollen im länderübergreifenden Forschungsprojekt „KlimaRhön“ Wege aufgezeigt werden. Welche Probleme das in der Rhön mit sich bringt, darüber haben sich die Projektverantwortlichen in einer digitalen Kick-off-Veranstaltung mit zahlreichen Akteuren aus dem UNESCO-Biosphärenreservat Rhön ausgetauscht. In den kommenden zwei Jahren werden mehrere Workshops angeboten, auf deren Grundlage Handlungsempfehlungen zu Anpassungen an den Klimawandel erarbeitet werden sollen. Die Verwaltungen des Biosphärenreservats hoffen auf eine rege Beteiligung der unterschiedlichen Akteure.
 |
| Die Folgen des Klimawandels machen sich längst auch im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön bemerkbar – wie im Schwarzen Moor, das unter den extremen Hitze- und Trockenperioden der vergangenen Sommer gelitten hat. / Foto: Alana Steinbauer |
Das transdisziplinäre Forschungsprojekt, das die Goethe-Universität Frankfurt am Main in enger Kooperation mit den drei Verwaltungen des UNSECO-Biosphärenreservats Rhön in Bayern, Hessen und Thüringen durchführt, läuft bis 2022 und wird vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) finanziert. Ziele sind die gemeinsame Risikobewertung hinsichtlich der klimabedingten Einschränkung der künftigen Wasserverfügbarkeit und die Erarbeitung von Anpassungsstrategien unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen. Denn: Landwirtschaft, Industrie, Tourismus, Privathaushalte – die Folgen des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit und die -qualität werden langfristig alle Bereiche des (öffentlichen) Lebens und Arbeitens beeinflussen.
Ein erster Schritt im Projekt war eine länderübergreifende Umfrage, zu der die Goethe-Universität im Sommer 2020 aufgerufen hatte. Darin ging es in der Hauptsache darum, wie die Folgen des Klimawandels hinsichtlich Wasserverfügbarkeit und -qualität bereits heute wahrgenommen werden, welche Ängste mit Blick auf die Zukunft bestehen und wie groß die Bereitschaft hinsichtlich Anpassungsmaßnahmen ist. An der Umfrage beteiligten sich rund 350 Rhöner Bürger*innen aus unterschiedlichen Interessensgruppen, darunter Land- und Forstwirtschaft, Natur- und Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft, Politik, Bildung und Tourismus.
Großteil bemerkt Einschränkungen bereits jetzt
Die Ergebnisse aus der Umfrage und Hintergründe zum Projekt stellten die Professorinnen Dr. Birgit Blättel-Mink und Dr. Petra Döll sowie die beiden Forschenden Laura Müller und Max Czymai aus natur- und sozialwissenschaftlicher Perspektive vor. Aus naturwissenschaftlicher Perspektive wurde gezeigt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft im Sommer weniger Niederschlag fallen und weniger Grundwasser gebildet werden könne. Bei der Darstellung wurde aber auch verdeutlicht, wie unsicher solche Abschätzungen für die Zukunft sind. Entscheidungen im Wassermanagement müssen also unter Unsicherheit getroffen werden. Bei der Umfrage wurde deutlich, dass bereits jetzt ein Großteil der Befragten eine Einschränkung der Wasserverfügbarkeit bemerke. In welchem Maße dieses Problem wahrgenommen und wie die zukünftige Bedrohung eingeschätzt wird, werde unter anderem vom Wohnort und der Berufs- beziehungsweise der Interessensgruppe der Befragten beeinflusst.
In der Wahrnehmung der Befragten habe die Wasserverfügbarkeit in den vergangenen drei Jahren in Thüringen am stärksten abgenommen. Den Befragten zufolge seien die Bereiche Land- und Forstwirtschaft, Natur- und Artenschutz sowie Gewässer- und Hochwasserschutz besonders stark vom Klimawandel betroffen. Perioden mit Bodentrockenheit und die Austrocknung von Flüssen, Bächen und Seen werden als besonders problematische Folgen der Klimaänderungen beurteilt und können mit einer Wasserknappheit einhergehen. Neben den Klimaänderungen werden seitens der Befragten insbesondere Privathaushalte und die Landwirtschaft für die wahrgenommene Abnahme der Wasserverfügbarkeit verantwortlich gemacht.
Mehrere Workshops geplant
„Mit Blick auf die Einwohnerzahl von 220.000 Menschen im Biosphärenreservat ist die Umfrage zwar nicht repräsentativ. Trotzdem sind die Ergebnisse robust genug, um weiter darauf aufzubauen“, erklärte Ulrike Schade, Leiterin der Thüringer Verwaltung. Anschließend diskutierten die rund 40 Teilnehmenden zu folgenden Fragen: Auf welche zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels, die nur unsicher abgeschätzt werden können, wollen wir uns einstellen? Was sind in den verschiedenen Anpassungsfeldern geeignete Anpassungsmaßnahmen? Auf welche Konflikte und Hindernisse könnten wir bei der Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen treffen? Darauf aufbauend wurde eine Priorisierung der Anpassungsfelder im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorgenommen.
Folgende Workshops sind in Zukunft geplant: „Szenarienentwicklung“, „Bayes’sches Netz (BN)“, „Mögliche Handlungsoptionen und Hindernisse identifizieren“, „Konkrete Anpassungsmaßnahmen entwickeln“ sowie „Handlungsempfehlungen auf Basis von BN, Stakeholder*innen-Expertise sowie Fokusgruppen und Evaluation“.
Mehr Informationen zum Forschungsprojekt
Die Pressemitteilung erschien erstmals am 17.02.2021 auf der Website des Biosphärenreservats Rhön.
Netzwerkforscher Christian Stegbauer über die "Gesellschaft im Zeichen des Virus"
Corona - auch ein Indikator für Ungleichheit
Sozialität im Dazwischen. Netzwerkforscher Christian Stegbauer spricht im neuen UniReport über sein Buch Corona-Netzwerke - Gesellschaft im Zeichen des Virus und den Verlust informeller Kontakte.
UniReport: Herr Professor Stegbauer, viele wissenschaftliche Disziplinen haben sich mittlerweile zur Corona-Pandemie geäußert. Was hat bei Ihnen die Idee reifen lassen, sich als Netzwerkforscher damit zu beschäftigen?
Christian Stegbauer: Als die Idee zu dem Buch entstand, waren es vor allem die Virologie und die Ökonomie, die die Debatte beherrschten. Diese Debatte erschien uns als zu schmal – zumal wir als Netzwerkforscher*innen uns im Zentrum des Geschehens bewegen: Das Virus verbreitet sich entlang der Strukturen sozialer Beziehungen und das ist das, womit sich die Netzwerkforschung beschäftigt. Vor fünf Jahren haben wir die Deutsche Gesellschaft für Netzwerkforschung gegründet. Zahlreiche Disziplinen haben den Wert dieser anderen Perspektive erkannt. Uns interessiert weniger der einzelne Mensch und sein individuelles Verhalten; wir schauen mehr darauf, wie sich Sozialität im Dazwischen, in den Beziehungen herstellt und welche Konsequenzen das hat.
Viren werden durch/bei Begegnungen von Mensch zu Mensch übertragen – stellt die Pandemie damit automatisch die Grundlagen von Mobilität und Globalisierung infrage?
Die Globalisierung der Wirtschaft und der Tourismus hat die Menschen näher zusammengebracht. Mit den Reisenden wandert auch das Virus. Eine mögliche Strategie, die Verbreitung entlang der Reisewege zu verringern, ist die Restriktion von Reisen. Das Zusammenrücken der Welt bedeutet aber auch, dass viele Familienbeziehungen leiden. Das gilt nicht nur für solche Menschen, deren Wurzeln aufgrund der Migration in anderen Ländern liegen. In der Wirtschaft diskutiert man darüber, ob man nicht auf viele Reisen verzichten könne und sich stattdessen auf Videokonferenzen beschränken könne. Diese Idee ist übrigens schon älter und trotzdem führte die Ausweitung von Beziehungen über Ländergrenzen hinweg zu immer mehr Reisen. Gegenseitiges Vertrauen generiert man am besten, wenn man sich trifft und neben dem Business auch persönliche Begegnungen hat. Dabei lernt man die Menschen viel besser kennen und es entstehen gegenseitige Verpflichtungen. Die Pandemie zwingt zu einer Einschränkung der direkten Kontakte und daher ist es wahrscheinlich, dass es danach sehr schnell wieder losgeht mit den Reisen.
In einem Beitrag beschäftigen Sie sich damit, dass das Virus nicht alle gleichmacht, sondern es ein Indikator für Ungleichheit ist. Können Sie das kurz verdeutlichen?
Zu Beginn der Pandemie wurde häufig geäu-ßert, dass das Virus ein Gleichmacher sei, weil sich auch zahlreiche Prominente infiziert hatten. Allerdings kann sich die verhältnismäßig reiche angestellte Mittelschicht in ihr einigermaßen sicheres Homeoffice zurückziehen. Sie hat dadurch mehr Autonomie über die eigenen Kontakte zu bestimmen. Die Arbeiter auf dem Bau, in den Schlachthöfen oder der Landwirtschaft hingegen, werden immer noch häufig in Sammelunterkünften untergebracht oder in engen Fahrzeugen zum Einsatzort gebracht. Diese können nicht über Distanzierung entscheiden – mit wem sie in Kontakt kommen, darüber bestimmen ihre Arbeitgeber. Ähnliches gilt natürlich auch für die im Frühjahr letzten Jahres sogenannten Coronaheld*innen. Diese kommen berufsbedingt mit sehr vielen Menschen in Kontakt. Diese neue Un-gleichheitsdimension könnte man als den Grad der Netzwerkautonomie bezeichnen – inwiefern man selbst über Kontakte und deren Reduzierung bestimmen kann.
Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit dem sogenannten »Hamstern«. Dies wurde im Zuge der Pandemie von den meisten Menschen als hochgradig irrationales und unsoziales Verhalten gegeißelt. Wie sieht die Netzwerkforschung die extreme Bevorratung bestimmter Produkte?
Das Hamstern hat seine Ursache vor allem in der Verunsicherung der Menschen und ihrer Bewältigung. Diese Unsicherheit wurde durch die Medien und Politik verstärkt, obwohl dies nicht intendiert war. Die Medien berichten immer von den Hotspots der Probleme und verstärken so deren Wahrnehmung. Die Politik behauptete zu Beginn der Krise, dass unser Gesundheitssystem bestens auf die Pandemie vorbereitet sei – das stellte sich sehr schnell als falsch heraus. Aus der Aussage, dass Masken nichts nutzten, wurde bis heute die Tragepflicht von FFP2-Masken. Zwar lernt man auch dort hinzu, aber wenn man durchschaut, dass diese Aussagen falsch waren, glaubt man dann den Aussagen, die Versorgung mit Nudeln und Toilettenpapier sei gesichert, wenn die Regale in den Geschäften leer sind? Durch die Kontaktbeschränkungen wurden die Möglichkeiten, sich mit anderen über die Lage zu unterhalten, stark reduziert. Das führte dazu, dass die Verunsicherung noch weiterwuchs, weil es schwer war, sich an der Praxis der anderen zu orientieren. Wo wir das Verhalten der anderen beobachten konnten, das war zum Beispiel in den Läden. Da wurden vor uns die letzten Nudeln herausgetragen. All das sorgte dafür, dass sich die Knappheit vergrößerte. Daraus ergab sich das Bedürfnis, die fehlenden Produkte ebenfalls zu bevorraten, weil die Befürchtung bestand, dass es nächstes Mal ausverkauft sein könnte. Dass dieses Verhalten die Knappheit eigentlich erst erzeugt, ist etwas, was man nur aus einer Makroperspektive analysieren kann. Das ist aber nicht die Verhaltens- und Orientierungsebene des Einzelnen.
Ein Bereich des Buches ist Arbeit, Wirtschaft und Technik gewidmet: Das Homeoffice wird in der Pandemie als Mittel zur Reduktion von Direktkontakten gesehen und darüber hinaus von vielen auch als Mittel der Flexibilisierung der Arbeitskultur geschätzt. Reichen die Kontakte über Telefon, Videochat und Mail, um den Anforderungen an soziales Netzwerken zu genügen?
All die technischen Hilfsmittel, um in Kontakt zu bleiben, sind hilfreich. Allerdings ersetzen sie nicht den persönlichen Umgang miteinander. In der Videokonferenz sieht man beispielsweise die anderen nur als einzelne Kacheln, weiß aber nichts über deren Verhältnis zueinander. Da ist es ganz schwer, Stimmungen abzuschätzen oder bei virulenten Problemen an verschiedene Argumente außerhalb der geplanten formalen Sitzungen heranzukommen. Für Organisationen kann man wohl sagen, dass das, was die eigentliche Organisation ausmacht, die informellen Kontakte, sehr stark leiden. Wir wissen aus der Organisationssoziologie, dass durch das Informelle das offiziell Geplante erst gängig gemacht wird. Insofern kann man sagen, dass die Kommunikation über Medien wohl nicht ausreicht. Unternehmen, die denken, jetzt könne man Büroraum abgeben und die Mitarbeitenden zu Hause lassen, werden die Probleme, die das verursacht, wahrscheinlich auch noch zu spüren bekommen.
Ein Beitrag beschäftigt sich mit den zahlreichen Talkshows im Fernsehen. Inwiefern greift auch hier der Netzwerkansatz, denn schließlich diskutieren hier zum Teil recht prominente (Einzel)Akteure?
In dem Beitrag wird analysiert, wer an welcher Talkshow teilgenommen hat. Dadurch erzeugt man ein sog. bimodales Netzwerk – aus Personen, die in Talkshows waren und den Talkshows selbst. So kann man zum Beispiel schauen, welche Gäste unterschiedliche Sendungen miteinander verbinden, weil sie in verschiedene Talkshows eingeladen wurden. Karl Lauterbach war zum Beispiel derjenige, der in allen Talkshows zu Gast war. Zwar spielt die Telegenität und Schlagfertigkeit bei deren Auswahl der Gäste auch eine Rolle, sie werden aber als Repräsentanten gesellschaftlicher Gruppen (etwa Parteien, Gewerkschaften oder Kirchen) eingeladen. Es kann auch sein, dass sie für gesellschaftliche Systeme stehen, wie für die Wirtschaft, die Gesundheit, die Kultur u. ä. So kann man mithilfe der Netzwerkanalyse zeigen, welche gesellschaftlichen Teilsysteme vorkamen und welche am zentralsten waren. Für die Wissenschaft insgesamt ist das Ergebnis eigentlich sehr gut, denn es kam kaum eine Talkshow ohne Vertreter aus der Wissenschaft aus.
Ihr Buch ist im Frühsommer 2020 entstanden; würden Sie mit Blick auf den weiteren Verlauf der Pandemie und besonders auf den aktuellen »harten« Lockdown andere Aspekte sehen?
Vielleicht kann man sagen, dass aus der Sicht der Netzwerkforschung, für die soziale Kontakte, deren Bedeutung und Struktur im Mittelpunkt steht, der Lockdown nicht hart genug ist. Was wir doch alle erleben, ist das große Bedürfnis, wieder mehr mit anderen Menschen zusammenzutreffen. Der Lockdown nun schneidet die wichtigen Beziehungen gefühlt endlos ab – ohne dass absehbar wäre, wann diese Entbehrung zu Ende ist. Im Gegenteil, eine Verlängerung der Beschränkungen reiht sich an die nächste. Ein kürzerer kompletter Lockdown hingegen würde die Aussicht auf etwas normalere Beziehungen erhöhen. Das wäre ein Preis, für den es sich lohnen würde, sich etwas mehr – aber nicht endlos anzustrengen.
Kann die Netzwerkforschung aus ihren Beobachtungen und Analysen auch Empfehlungen für künftige Krisen dieser Art gewinnen?
Menschen sind so konstituiert, dass sie ohne soziale Kontakte nur schwer leben können. Ihnen fehlt dann nicht nur die Nähe und Zuneigung, ihnen fehlt auch ein großes Ausmaß an dem, was man als soziale Integration bezeichnen könnte. Hierdurch entstehen erst unsere Identitäten, aus denen wir als Menschen unsere Orientierung ableiten können. Das hat aus der Netzwerkperspektive genauso einen hohen Stellenwert wie die Prosperität der Wirtschaft. Das Abschneiden von Kontakten wirkt sich auch auf die Gesundheit aus, die Wirkung geht aber weit darüber hinaus. Man kann sich wünschen, dass solche Aspekte bei der Bekämpfung künftiger Krisen Berücksichtigung finden. Da man sich aneinander orientiert, dürften Vorbilder eine gewisse Rolle spielen. Wenn die anderen Familienmitglieder, die Nachbarn oder die Kolleginnen und Kollegen sich impfen lassen, wird es schwer sein, eine Argumentation dagegen aufrechtzuerhalten. Auch hier sind Kontakte wichtig, weil sie dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Denken Sie, dass die Pandemie zu dauerhaften Veränderungen im Sozialverhalten führen könnte, vor allem bei von Ihnen im Buch als »super schwache Beziehungen« bezeichneten Kontakten auf Volksfesten oder Clubs?
Super schwache Beziehungen finden sich häufig. Sie spielen für die Pandemie dann eine Rolle, wenn einander unbekannte Menschen sich sehr nahekommen. Während wir im Alltag meist nur auf dieselben Personen treffen, wird dieses Schema im Urlaub beispielsweise gebrochen. Wenn sich dort Leute zum Beispiel aus verschiedenen Ländern treffen, dann ist das die Chance für das Virus, sich in Bereiche zu verbreiten, die es sonst nicht erreichen könnte. Wenn es das Virus dann an einen anderen Ort geschafft hat, verbreitet es sich dann allerdings wieder regulär, das heißt innerhalb der regelmäßigen engen Kontakte. Insofern könnte man bei den super schwachen Beziehungen am ehesten Kontaktreduzierungen durchführen, um eine Verbreitung in neue Gebiete zu verhindern. Andererseits ist der enge Kontakt mit Menschen, denen man sonst nicht begegnet, besonders bereichernd. Diese Menschen sind interessant, denn man erfährt Dinge, die einem sonst nicht zugänglich sind. Es mag also es kurz nach Ende der Pandemie noch eine gewisse Skepsis gegenüber solchen Orten geben, aber das dürfte nur von kurzer Dauer sein.
Fragen: Dirk Frank
 |
Stegbauer, Christian, Clemens, Iris (Hg.): CoronaNetzwerke – Gesellschaft im Zeichen des Virus. Wiesbaden, Springer 2020 |
Das Interview erschien im UniReport 1/2021.
Eine Analyse zur Corona-Krise von Katharina Hoppe
Die Freiheit zur Verleugnung - oder: Keine Helden braucht das Land
„Freiheit vor Fürsorge“ – dieser Slogan ließ sich auf einem Schild bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München im Juli 2020 lesen. Die Geste, Freiheit und Fürsorge einander gegenüberzustellen, ruft einen ganzen Katalog herrschaftsförmiger Dualismen auf, die das westliche Denken tief prägen. Dabei handelt es sich um Begriffspaare, in denen die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und feminisierter Arbeit ebenso angelegt ist wie eine Geringschätzung des Reproduktiven, Körperlichen, Verletzlichen. Mit dem Freiheitsbegriff werden eine männlich konnotierte Souveränität und Unabhängigkeit identifiziert, während dem weiblich konnotierten Begriff der Fürsorge Abhängigkeit und Zwang zugeschrieben wird. Eine Seite der Unterscheidung unterliegt dabei der Abwertung: So wird das „Weibliche“, das „Irrationale“ oder das „Primitive“ mit dem Natürlichen identifiziert, das zwar passiviert wird, aber paradoxerweise auch als prinzipiell bedrohlich und relativ unverfügbar gilt und daher zu beherrschen ist. Und zwar zu beherrschen durch das Aktive und Überlegene, das „Männliche“, die „Kultur“, die „Rationalität“ oder die „Technik“. Dieser Logik unterliegt auch das Begriffspaar Freiheit und Notwendigkeit. Notwendigkeit ist darin etwas Abzulehnendes, Bedrohliches, weil es mit Alternativlosigkeit und Zwang in Verbindung gebracht wird. In der Szene der sogenannten Querdenker wird Notwendigkeit identifiziert mit „Fürsorge“, die Freiheit untergräbt, während andersherum Freiheit als Abwesenheit jeglicher Notwendigkeit vorausgesetzt wird.
Die Covid-19-Pandemie hat konkreter und vor allem schneller als es die immer noch zu abstrakt vorgestellte Größe des Klimawandels vermag, die intrinsische Verwiesenheit der Pole Freiheit und Fürsorge (oder Notwendigkeit) spürbar gemacht. Die gegenwärtige Intensität der Krisenerfahrung speist sich nicht zuletzt aus einer Erfahrung substanzieller und nicht unmittelbar regierbarer Abhängigkeit. Das Abhängigkeitsgeflecht, das gegenwärtig spürbar wird, muss als Gefüge verstanden werden, in dem das Biologische und das Soziale nicht voneinander ablösbar sind: Ohne eine wie auch immer geartete Sozialität können Viren sich nicht verbreiten, sie kleben gleichsam an den Bewegungsprofilen ihrer Wirtsorganismen. Daher ist die Beschreibung der Pandemie als biosozialer Prozess sinnvoll. So kann auf die lebenserhaltenden, gleichzeitig natürlichen und kulturellen Bedingungen der Existenz hingewiesen werden. Die ihrerseits dualistische Vorstellung, das Soziale oder das Kulturelle ständen der Natur äußerlich gegenüber, führt das Virus ad absurdum. Die Zoonose ist die psychotische Kehrseite einer Produktions- und Lebensweise, die Lebensräume unterschiedlichster Spezies verkleinert, unbewohnbar macht, Spezies näher aneinanderrücken lässt und dadurch die Verbreitung und Entstehung von Viren begünstigt. Die pandemische Konstellation macht also in aller Deutlichkeit spürbar, dass eine klare Abgrenzung von Natur und Kultur nicht funktioniert – vom „Anderen“, dem Natürlichen, hängen „wir“, hängen die Kultur, die Ökonomie, die Produktion immer schon ab. Die Gegenüberstellung Kultur/Natur kann strukturanalog gelesen werden zu Freiheit/Fürsorge. Natur, Fürsorge und Notwendigkeit werden dabei mit dem „Weiblichen“ in Verbindung gebracht, als bedrohlich empfunden; in der Folge wird eine Rationalität etabliert, die sich gegen diese wendet – gegen Frauen und andere als anders markierte Personen ebenso wie gegen die Vorstellung, selbst auf ‚Natur' oder auf Fürsorge angewiesen zu sein. Die Konfrontation mit der Unverfügbarkeit von Viren, von Natur-Kultur-Gefügen, hat daher massive Abwehrreaktionen hervorgerufen.
Die Pandemieerfahrung ist nun in der Tat eine ungekannte Begegnung mit Prekarität – eine Begegnung, die schwer auszuhalten ist, und zwar besonders dann, wenn die eigene Freiheit als völlig abgekoppelt von sozialen, infrastrukturellen und natürlichen Abhängigkeiten, ja, sogar von Fürsorge konzipiert wird, also als abgelöst vom Notwendigen. Diese Freiheit ist eine Freiheit der Verleugnung von Abhängigkeiten, die unter den Vorzeichen einer Pandemie ungleich mehr betont werden muss. Denn die Verleugnungsleistung wird tatsächlich prekär, wenn sie ob der pandemischen Erfahrung, die die Spürbarkeit der eigenen Abhängigkeiten so deutlich erhöht, kompliziert zu werden droht. Es ist dieses Gefühl einer bedrohten Souveränität und der mit dieser Vorstellung zusammenhängenden falsch verstandenen Freiheit als radikaler Unabhängigkeit, die abgeschlossenen Weltbildern, Nationalismen und auch faschistischen Tendenzen in die Hände spielt.
Während die Pflegekräfte nicht als Fürsorgende für andere, sondern als Held*innen im Kampf gegen das Virus gefeiert wurden – was selbstverständlich keine nennenswerte monetäre oder gesellschaftliche Aufwertung ihrer Tätigkeiten zur Folge hatte –, hat sich ein bemerkenswerter weiterer Heldendiskurs ausgebildet, der frappant jene Gefahr zuspitzt, die in der systematischen Verleugnung, Verachtung und Beherrschung des Reproduktiven und Natürlichen angelegt ist. Wiederum auf einem Demo-Schild, diesmal bei der Querdenker-Demonstration in Stuttgart im Mai 2020, ließ sich lesen: „Lieber stehend sterben als kniend leben!“ Hier wird der Tod – jene Notwendigkeit, die schlichtweg nicht zu verleugnen ist – einer heroischen Souveränitätsfiktion unterstellt. Umberto Eco hat in seinen Arbeiten zum Faschismus den engen Zusammenhang zwischen dem „Kult des Heroismus“ und dem „Kult des Todes“ hervorgehoben: „In jeder Mythologie ist der Held ein Ausnahmewesen, aber in der Ideologie des Ur-Faschismus ist Heroismus die Norm. […] Der urfaschistische Held […] ersehnt den Heldentod, der ihm als die beste Belohnung eines heroischen Lebens gepredigt wird.“ [1] Der so verstandene Held stilisiert seine Auflehnung, die sich gegen fremde Mächte sowie etablierte Autoritäten richtet, als Selbstaufopferung im Widerstandskampf. [2] Deutlich wird dabei, dass er keinen Umgang mit den Notwendigkeiten des Lebens findet und seine Abhängigkeit von Fürsorge ebenso wie die eigene Vulnerabilität verleugnen muss. Ein solcher Heroismus ist zutiefst vergeschlechtlicht – die Freiheit des Helden ist die Freiheit von der Notwendigkeit und hier besonders die vermeintliche Freiheit von Körperlichkeit und Angewiesenheit auf andere. Es handelt sich um einen Heroismus, der alles ‚Weibliche' – vor allem die eigenen bedürftigen Anteile – verleugnen muss und demgegenüber männlich konnotierte Begehrensstrukturen über sich hinaustreibt. Darin wird auch der misogyne Zug dieser Abwertungs- und Verleugnungsmechanismen deutlich. Was die Corona-Krise jedoch sichtbar macht, ist gerade, dass es ein Fehler ist, Freiheit und Notwendigkeit in dieser Weise gegeneinander auszuspielen. Freiheit ist nur unter guten Bedingungen der Fürsorge – vom Zugang zu sauberem Trinkwasser über stützende Nahbeziehungen bis hin zu kostenfreier Gesundheitsversorgung – überhaupt möglich. Ja, womöglich realisiert sich Freiheit allein in sorgenden Abhängigkeitsverhältnissen. Dann wäre sie auch verknüpft mit einer Forderung nach Politiken der Notwendigkeit und der Fürsorge, die die komplexen Ermöglichungsbedingungen eines guten Lebens für alle jenseits einer allein ökonomischen Logik einfordern.
Die völlige Negation eigener Abhängigkeiten und Bedürfnisse im Heroismus der „Querdenker“ ist indes nur die Überspitzung einer weiter verbreiteten gefährlichen Souveränitätsfiktion, in der sich auch Klimawandelleugnende und „Querdenker“ treffen. Die Pandemie und ihre Folgen ebenso wie die Konsequenzen der globalen Erderwärmung können als Erinnerungen an Abhängigkeitsverhältnisse verstanden werden. Sie sind die Erinnerung daran, dass wir mit nicht unmittelbar Präsentem oder auch Abstraktem zu tun haben, also unsere Praktiken mit Ereignissen und Gefährdungen, die weit weg erscheinen, verwoben sind. Etwa werden große Flächen des Amazonasgebietes auch zur Aufrechterhaltung ‚unserer' Lebensform abgeholzt. Wir hängen ab von unzähligen menschlichen und nicht menschlichen Organismen, Entitäten, Strukturen – und das im Guten wie im Schlechten. Diese Komplexität ist eine Zumutung, und dennoch ist die annähernde Vergegenwärtigung der eigenen Abhängigkeiten politisch geboten, wenn wir auch nur einen Bruchteil der sich zuspitzenden Krisen begreifen wollen; ihre Verleugnung hingegen ist der sichere Weg in die Katastrophe. Sticker wie „I love Klimawandel“ auf SUVs demonstrieren diese Verleugnung ganz genauso wie die heldenhafte Inszenierung der Freiheit als Unverwundbarkeit oder des Willens zum Helden(tod). Dabei ist es nur eine spezifische – antiquierte – Vorstellung von Freiheit, die hier bedroht ist: nämlich jene, die diese in radikaler Unabhängigkeit und Souveränität aufgehen lässt. Die Freiheit zur Verleugnung ist blutleer, weil sie keine Bedingtheiten kennt und in ihren Überspitzungen gefährlich ist. Das Virus zwingt demgegenüber dazu, darüber zu debattieren und nachzudenken, wie mit Unverfügbarkeit, Notwendigkeit und unserer „Natur“ – als einer auf andere und anderes angewiesenen – besser umgegangen werden kann. Die Frage, wie mit biosozialen Abhängigkeiten gelebt werden kann, wird ohne Zweifel bleiben und kann sich einen defizitären gesellschaftlichen Umgang mit Notwendigkeit und Abhängigkeit nicht leisten. Die Kosten der Verleugnung von anderen und anderem, die an ‚uns' gebunden sind, sind hoch, nicht nur, weil das Natürlich-Kulturelle zurückschlägt und eben nicht gänzlich kontrollierbar ist, sondern auch, weil das Leben einiger darin einer nekropolitischen Logik unterworfen wird. Das Sterben-Lassen in der Pandemie und an den europäischen Außengrenzen ist auch auf Verdrängungsleistungen und (heroische) Souveränitätsfiktionen angewiesen: Keine Helden braucht das Land, sondern postheroische Transformationen von Abhängigkeitsverhältnissen.
Anmerkungen
| [1] | Umberto Eco, Der ewige Faschismus, München 2020, S. 36. |
| [2] | Vgl. zum Motiv des Widerstands gegen etablierte Autoritäten bei den Corona-Protesten die Ergebnisse der empirischen Studie von Oliver Nachtwey/Robert Schäfer/Nadine Frei, Politische Soziologie der Corona-Proteste, 2020, besonders S. 57. Die Studienergebnisse sind online verfügbar unter: https://osf.io/preprints/socarxiv/zyp3f. |
Dr. Katharina Hoppe ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Soziologie mit dem Schwerpunkt Soziale Ungleichheit des Instituts für Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt.
Der Text erschien erstmals am 27. Januar 2021 im Rahmen der Kolumne This is Tomorrow auf www.textezurkunst.de
KONTAKT
Institut für Soziologie
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften
Goethe-Universität Frankfurt a.M.
Campus Westend – PEG-Gebäude
Theodor-W.-Adorno-Platz 6
60323 Frankfurt am Main
Postadresse:
Institut für Soziologie
Hauspostfach 10
60629 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor
Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty
sutterluety@em.uni-frankfurt.de
Institutsreferent
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity