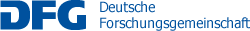
Dieses Graduiertenkolleg beschäftigt sich vor dem Hintergrund der Krise der repräsentativen Demokratie mit der Aushandlung, Umsetzung und Bewertung von Standards des guten Regierens. Der Begriff des guten Regierens, oder der „good governance“, ist weltweit verbreitet und wird von internationalen Organisationen propagiert. Darunter fallen allgemeine Normen der guten Regierungsführung wie Transparenz, Partizipation und Verantwortlichkeit („accountability“) der Regierenden, aber auch spezifische wie Geschlechtergerechtigkeit, Korruptionsbekämpfung oder die systematische Evaluation von Politiken.
In Kooperation mit Technische Universität Darmstadt
Sprecher*in: Prof. Dr. Jens Steffek
Laufzeit: 2023 - 2028
Link zum Projekt
Was erklärt Vertrauen in die Politik? Die Rolle politischer Repräsentation (TRUPOL)
Das Projekt untersucht den Einfluss deskriptiver und substantieller Repräsentation auf politisches Vertrauen. Spezifische Fragen sind, ob die anteilige Repräsentation sozialer Gruppen zu mehr personalisiertem Vertrauen auf Seiten der Gruppenmitglieder führt, wie dieser Zusammenhang von substantieller Repräsentation beeinflusst ist, und welche weitergehenden Einstellungseffekte aus personalisiertem Vertrauen entstehen.
Daten: Surveys, experimentelle Verfahren
Geographischer Raum: Deutschland, Großbritannien,
Schweiz
Projektleitung: Prof. Dr. Thomas zittel
Laufzeit: 2023 - 2025
The
Nature of Political Representation in Times of Dealignment (NAPRE)
Das Projekt untersucht die
kommunikative Responsivität von Abgeordneten in Europäischen
Demokratien. Dabei stellt es die Frage, wer oder was in Zeiten verringerter Parteibindungen
zu welchem Grad repräsentiert wird und wie dies durch
wahlsystemische Anreize und die persönlichen Eigenschaften der Mandatsträger
beeinflusst ist.
Daten: Feldexperimente und
quantitative Analyse parlamentarischer Texte.
Geographischer Raum:
Deutschland, Großbritannien, Niederlande
Projektleitung: Prof. Dr. Thomas zittel
Laufzeit: 2019 - 2023
Ministries of Finance and the Politics of
Social Policy-Making
(Julian Garritzmann & Katrijn
Siderius)
When interviewing policy-makers for
a book on the role of public opinion for education policy-making (Busemeyer,
Garritzmann, Neimmans 2020), our interview partners kept highlighting the role
of Ministries of Finance (MoFs). This was unexpected, since MoFs are not
recognized as an important actor in welfare state research. Against initial
anecdotal evidence, this project systematically analyzes the role of MoFs for
social policy-making. It theorizes that and why MoFs have become an
increasingly important – but scholarly neglected – actor in the politics of
social policy-making, and proposes a framework to empirically explore the
(complex) mechanisms through which MoFs affect policies. We systematically
study the policy impact of MoFs across countries, social policy areas, and over
time, thereby connecting and expanding welfare state research, political
economy, public policy, and public administration research. Empirically, we
employ a multi-method design, systematically collecting information on the
characteristics and powers of MoFs, conducting a new expert survey among social
scientists on MoFs , and studying MoFs' role in social policy-making in
comparative case studies.
Projektleitung: Prof. Dr. Julian Garritzmann
Laufzeit: 2023 - 2025
Leibnizpreis-Forschungsgruppe
Transnationale Gerechtigkeit
Die Leibnizpreis-Forschungsgruppe Transnationale Gerechtigkeit
beschäftigt sich mit unterschiedlichen Aspekten einer kritischen Theorie der
Gerechtigkeit jenseits des Staates, von den normativen Grundlagen und
Verwendungsweisen des Begriffs der Gerechtigkeit innerhalb verschiedener
sozialer, politischer und philosophischer Kontexte bis hin zu den zentralen
Ungerechtigkeiten der gegenwärtigen transnationalen Ordnung. Eine Theorie
transnationaler Gerechtigkeit muss nicht nur die Realitäten der transnationalen
Ökonomie sowie politische und rechtliche Verhältnisse in den Blick nehmen; sie
muss auch auf Grundlagen beruhen, die universale Gültigkeit beanspruchen
können.
Ein Ziel ist es daher, ein transnationales Netzwerk mit Forscherinnen und
Forschern aus allen Regionen der Welt aufzubauen, um mit ihnen Probleme der
Gerechtigkeit in transnationaler Perspektive zu diskutieren. Aktuell bestehen
Kooperationen mit ForscherInnen in Lateinamerika, Nordamerika, Afrika, dem
Mittleren Osten, Indien und China.
Finanziert wird die Leibniz-Forschungsgruppe aus Mitteln des Leibniz-Programms
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die Prof. Dr. Rainer Forst 2012 den
Gottfried Wilhelm Leibniz Preis verlieh.
Projektleitung: Prof. Dr. Rainer Forst
Laufzeit: 2012 - 2025
Recasting the Role of Citizens in Foreign and Security Policy? Democratic Innovations and Changing Patterns of Interaction between European Executives and Citizens
For the last decade, European democracies have witnessed several instances of a previously unknown involvement of citizens in political issues with a global dimension. Politicians and members of national executives in Europe have started to actively engage citizens in policy- and decision-making processes in the field of foreign and security policy (FSP). In fact, some governments, as well as international organisations such as the European Union (EU), have been initiating dialogue and participation processes, aiming at a larger inclusion of civic organisations, scientific experts and, remarkably, ordinary citizens in FSP.
Our project investigates this change of the role of citizens in the field of FSP. More specifically, we reconstruct how and why national governments introduce democratic innovations (DIs) to this policy field, usually considered as being dominated by the executive. We assume that understandings of how relations between the executive and citizens should be organised, as held by ministerial elites in FSP, have changed in some countries during the last decade. These changes of the citizen's role also have ramifications for the politics in FSP, notably the intra- and inter-ministerial processes of policy- and decision-making, as well as relations between the executive and legislative in this policy field.
In order to analyse why executive actors (do not) offer DIs, we apply a small-n and cross-national comparative method. We empirically map and theoretically conceptualise executive-citizens relations in FSP by comparing the cases of France, Germany, Poland, and the UK.
A more detailed project description can be found here.
Funded by the German Research Foundation, Principal Investigator (in cooperation with Anna Geis and Christian Opitz from Helmut-Schmidt-Universität/Universität der
Bundeswehr Hamburg)
Projektleitung: Prof. Dr. Anna Geis, Prof. Dr. Hanna Pfeifer
Laufzeit: 2022-2025
Link zum Projekt
Populistischer Gegenschlag, demokratische Abkehr und die Krise des Rechtsstaats in der Europäischen Union
Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Nölke
Laufzeit: 2020 - 2023
Finanzialisierung und Staatskapitalismus: Die Steuerung der Kapitalmärkte in den BRICSS
Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Nölke
Laufzeit: 2020 - 2024
Der Einfluss von Sozialstruktur, Diskriminierung und Gewalt auf Muslime in Deutschland
Projektleitung: Prof Dr. Sigrid Roßteutscher, Prof. Dr. Constantin Ruhe, Prof. Dr. Richard Traunmüller
Laufzeit: 2021 - 2025
Daten: Surveys, experimentelle Verfahren
Geographischer Raum: Deutschland, Großbritannien, Schweiz
Laufzeit: 2023 – 2025
Link zum Projekt
Auf was können wir uns einigen? Theoriebildung und Modellierung von Friedensvertragsinhalten, Kompromissbereitschaft und deren Einfluss auf bewaffneten innerstaatlichen Konflikt
Projektleitung: Prof. Dr. Constantin Ruhe
Laufzeit: seit 2020
Legitime Multipolarität
In den letzten Jahren leistete die Politikwissenschaft einen entscheidenden Beitrag zur komparativen Analyse organisierter Interessen im politischen Prozess. Bisher wurden die postkommunistischen Länder jedoch weitgehend vernachlässigt. Stattdessen richtete die politikwissenschaftliche Osteuropa-Forschung den Blick hauptsächlich auf die Entwicklung formaler politischer Institutionen sowie auf Parteiensysteme und die Europäisierung von öffentlichen Verwaltungen in der Region. Mit diesem Forschungsvorhaben möchten wir einen Beitrag zur Überwindung dieses Forschungsdesiderates leisten, indem wir die Strukturen, die demokratisch-partizipative Einbindung sowie den Einfluss von organisierten Interessen auf den Politikgestaltungsprozess in vier postkommunistischen Staaten (Polen, Tschechien, Slowenien und Ungarn) untersuchen.
Projektleitung: Prof. Dr. Heike Holbig
Laufzeit: Seit 2018
Politics of Money
The Resilience of Finance Capitalism
Brexit-Referendum, die Wahl Donald Trumps und die andauernde Eurokrise haben manche Gewissheiten in Europa und den USA erschüttert.
Protektionismus und Nationalismus sind im Aufwind und regionale Integration und transnationale Handelsabkommen kommen scheinbar außer Mode. Ungebrochen jedoch ist der Stellenwert des Finanzsektors in Großbritannien und den USA. Dem Finanzkapitalismus geht es gut. Diese Resilienz des Finanzkapitalismus steht im Zentrum unseres anvisierten Nachwuchsnetzwerkes. Um diese Resilienz besser zu verstehen, werden wir in diesem Forschungsnetzwerk die grundlegende Rolle des Geldes innerhalb der Infrastruktur des globalen Kapitalismus analysieren. Indem wir uns mit jüngeren Arbeiten aus der Geldtheorie und der Finanzökonomie auseinandersetzen, möchten wir dazu beitragen, das Studium des Geldes, welches das Herzstück der globalen politischen Ökonomie darstellt, als zentralen Bestandteil der Politikwissenschaft zu etablieren.
Projektpartner an der Goethe Universität: Prof. Dr. Andreas Nölke
Laufzeit: 2017 - 2023
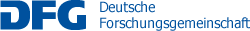
Human rights Discourse in Political Protests of Refugees and Undocumented Migrants in Germany and the US

Research Group: Human Rights Discourse in Migration Societies (MeDiMi)
Funding: DFG
Duration: October 2022-September 2026
Principal
Investigator: Prof.
Dr. Encarnación
Gutiérrez-Rodríguez
This research project aims at
examining human rights discursive practices of refugee and migrant activists in
the context of undocumented and precarious migration. It focuses on political
interventions and articulations from the 1990s until today in Germany and in
the USA, in particular on how political self-organized migrant and refugee
groups address and denounce the tension between human rights as norms and their
factual implementation.
The idea of the project emerged from the observation that human (and civil)
rights are not merely given or conclusive. They are constantly disputed,
invoked, and evoked by self-organized political groups and organizations of
persons subjected to migration and asylum laws constraining their access to
basic rights such as freedom of movement, housing, education, health, work, and
social welfare. This project sheds
light on different understandings of human rights as rights addressing the
dehumanizing effects of asylum and migration control policies, as well as on
alternative visions of justice, juridical recognition, and political
participation. In doing so, the project points to a rather unexplored
entanglement between asylum and migration control policies and
(neo-/post-)colonial global inequalities.
From a position of politically
engaged researchers and activists, the research team takes a feminist,
anti-racist, decolonial perspective on knowledge production, regarding research
as an instrument that should benefit refugees and migrant movement activists. The
research team works methodologically on two levels. It conducts a critical
analysis of digital archives in the outlined research field, while it also
engages with community-oriented and participatory research.
Further information:
- Research Group Homepage
- Subproject Page
- MeDiMi Conference 18-20 September 2024 at Justus Liebig University Giessen
Projektleitung: Prof. Dr. Encarnación Gutiérrez-Rodríguez
Projektlaufzeit: 2022 - 2026
Internalized Gender and Parenting Norms: Assessing Reconfigurations between Gender, Socio-Economic Status and Immigrant Background
Projektleitung: Prof. Dr. Birgit Becker, Prof. Dr. Daniela Grunow
Projektlaufzeit: 2021 - 2025
Die Rolle von internalisierten Wirksamkeitsüberzeugungen für die Partizipation in Bildung und Politik
Aufgrund von sozialem Wandel, insbesondere Bildungsexpansion und Massenmigration, gab es in den letzten Jahrzehnten nicht nur eine generelle Zunahme an höherer Sekundärbildung, sondern es hat auch eine Rekonfiguration von sozialer Herkunft, Migrationshintergrund und der Positionierung im deutschen Bildungssystem stattgefunden: Mehr Jugendliche aus unteren sozialen Schichten oder mit Migrationshintergrund befinden sich in höheren Schulformen. Damit ergeben sich jedoch auch vermehrt Statusinkonsistenzen, z.B. für Jugendliche aus höheren Schichten mit einer weniger erfolgreichen Schulkarriere oder für schulisch sehr erfolgreiche Jugendliche mit Migrationshintergrund. In diesem Projekt untersuchen wir, wie solche widersprüchlichen Einflüsse der Familie und Schule die Wirksamkeitsüberzeugungen von Jugendlichen auf verschiedenen Ebenen (Individuum, Gruppe, System) beeinflussen, d.h. ihre Vorstellung davon, was sie als Individuum, als Mitglied einer bestimmten sozialen Gruppe sowie innerhalb eines gesellschaftlichen Systems erreichen können. Wir sehen Schulen hierbei als zentral an, da Jugendliche nicht nur viel Zeit in der Schule verbringen, sondern hier auch ihre ersten Erfahrungen mit einer gesellschaftlichen Institution und deren Repräsentanten (den Lehrkräften) machen und lernen, wie sie und ihre Gruppe in diesem System behandelt werden. Wir gehen davon aus, dass diese Erfahrungen nicht nur die Wirksamkeitsüberzeugungen im Bereich Bildung prägen, sondern auch auf andere Bereiche wie die Politik übertragen werden und daher auch das Verhalten in verschiedenen Lebensbereichen beeinflussen. Konkret untersuchen wir 1.) wie ein privilegierter vs. benachteiligter Familienhintergrund (gemessen durch soziale Herkunft und Migrationshintergrund) mit einer (weniger) erfolgreichen Bildungskarriere interagiert, um die Wirksamkeitsüberzeugungen von Jugendlichen im Bereich Bildung zu beeinflussen, 2.) ob und wie diese in der Schule entwickelten Wirksamkeitsüberzeugungen auf den Bereich der Politik übertragen werden, und 3.) wie sich diese Wirksamkeitsüberzeugungen auf das tatsächliche Verhalten auswirken (d.h. auf Bildungsentscheidungen und politische Partizipation).
Wir untersuchen diese Fragestellungen, indem wir eine eigene Datenerhebung (als Teil des RISS Internalization Surveys) mit der Analyse existierender Paneldaten verbinden. Die Fragestellungen 1 und 2 werden mit den Daten des RISS Internalization Surveys untersucht, wobei wir eine Online-Befragung von Jugendlichen planen. Die Umsetzung von Wirksamkeitsüberzeugungen in späteres Verhalten (Fragestellung 3) wird sowohl anhand von Sekundärdaten untersucht als auch auf Basis eines Panel-Designs.
Projektleitung: Prof. Dr. Birgit Becker, Prof. Sigrid Roßteutscher, PhD
Projektlaufzeit: 2021 - 2025
Making Benefits Work. Characteristics and Effects of In-Work Benefits in Different Welfare State Contexts
Projektleitung: Jan Brülle
Proejtktlaufzeit: 2023 - 2025
The Rural-Urban Divide in Europe (RUDE)
Zunehmender Populismus und zunehmende Polarisierung verbunden mit abnehmender demokratischer Legitimität deuten auf eine Krise in europäischen Demokratien hin. Diese Krise hat eine regionale Dimension: ein politisches und vielleicht auch kulturelles Gefälle zwischen Stadt und Land. Das Projekt untersucht, ob und wie das Wohnen in der Stadt oder auf dem Land mit Unterschieden in Legitimitätsüberzeugung, sozialer Identität, der Wahrnehmung von Ungerechtigkeit und Bedrohung, politischen und sozialen Einstellungen und dem politischen Verhalten europäischer Bürger zusammenhängt. Es betrachtet “Democratic governance in a turbulent age", demokratische Staatsführung in unruhigen Zeiten, aus verschiedenen Blickwinkeln. Zum einen befasst es sich mit dem Wandel von Identität und dessen Konsequenz für demokratische Staatsführung und politische Repräsentation. Stabile Konfliktlinien entstehen nur, wenn das Ringen um Identität von der Wahrnehmung sozialer Ungleichheit und unfairer Ressourcenverteilung begleitet ist. Zum anderen untersucht es die Rolle der Globalisierung: das zunehmende ökonomische Gefälle zwischen Stadt und Land führt zu einer Bedrohung des sozialen Status, die das politische Gefälle zwischen Stadt und Land weiter verschärft. Das Projekt wird eine breit angelegte vergleichende Studie zu allen europäischen Ländern mit einer eingehenden Analyse von fünf etablierten europäischen Demokratien kombinieren. Es wird bedeutende neue Befunde zu Unterschieden zwischen Stadt und Land in der europäischen Politik liefern, die es uns ermöglichen werden, die Folgen – und die Heilmittel – der gegenwärtigen Krise der Demokratie zu untersuchen und dabei sowohl Wissenschaftler als auch politische Entscheidungsträger als Zielgruppe anzusprechen.
Projektleitung: Prof. Sigrid Roßteutscher, PhD
Projektlaufzeit: 2021 - 2023
Technologie statt Institutionen? Die Blockchain-Technologie als Bedrohung des Bankensystems
Die wohl bekannteste Anwendung der Blockchain-Technologie ist Bitcoin, die erste digitale Währung (Kryptowährung), mit der in einem weltweiten dezentralen Zahlungssystem Transaktionen abgewickelt werden können. Dabei hat sich schnell herausgestellt, dass die Anwendungsmöglichkeiten von Blockchain weit über digitale Währungen hinausgehen. Eine ganze Reihe kommerzieller Akteure, zunächst Start-ups, aber auch Banken und traditionelle IT-Unternehmen wurden dadurch motiviert, sich an der Weiterentwicklung von Blockchain zu beteiligen. Blockchain verspricht, die bisher zur Validierung von Transaktionen notwendigen (Macht-) Instanzen wie Staaten, aber auch Banken oder Kreditkartenfirmen auszuschalten. Transaktionen aller Art, vom Zahlungsverkehr bis hin zur vertraglichen Festlegung von Eigentumstiteln, sollen nun auf Peer-to-Peer-Basis stattfinden und müssen nicht mehr durch eine dritte Instanz verifiziert werden. Dieses Forschungsprojekt stellt die Frage nach der Realisierbarkeit der Ankündigung der Blockchain-Apologeten, alle Intermediäre überflüssig zu machen und durch dezentral organisierte Peer-to-Peer-Netzwerke zu ersetzen. Diese Frage ist nicht nur von spekulativem Interesse, sondern soziologisch bzw. politökonomisch in höchstem Maße relevant, da ihre Beantwortung an die Grundfesten der kapitalistischen Gesellschaftsordnung rührt. Kapitalistische Wirtschaftssysteme sind auf zentralisierte Austauschsysteme mit dominierenden Akteuren, etwa Zentralbanken, angewiesen.
Projektleitung: Prof. Dr. Barbara Brandl
Projektlaufzeit: 2020 - 2023
Religiöse und nichtreligiöse Kontingenzbewältigung in der individualisierten Gesellschaft
Kontingenzbewältigung wird in den Sozial- und Geisteswissenschaften in erster Linie als ein religiöses Phänomen betrachtet. Durch eine derart verengte Sicht haben nichtreligiöse Formen der Kontingenzbewältigung nicht die systematische Beachtung gefunden, die sie verdienen. Darüber hinaus mangelt es den überwiegend theoretischen und ideengeschichtlichen Analysen zu Kontingenzerfahrungen und ihrer Bewältigung nicht nur an empirischen Fundierungen, sondern auch an gegenstandsadäquaten begrifflichen Konturierungen. Das Vorhaben widmet sich diesen Desideraten: Es werden sowohl religiöse als auch nichtreligiöse Praktiken der Kontingenzbewältigung in den Blick genommen. Dabei beforscht das Projekt spezifisch moderne Kontingenzerfahrungen, die durch gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen hervorgerufen und von Akteurinnen und Akteuren im Modus einer Biographisierung des Lebenslaufs erlebt werden. Das Ziel ist die Entwicklung einer empirisch begründeten Theorie, die religiöse und nichtreligiöse Strategien der Kontingenzbewältigung in ihrer Entstehung, Anwendung und Wirkung erklärt.
Projektleitung Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty
Projektlaufzeit: 2020 - 2023
Familiäre Instabilität und Bildungsungleichheit: Eine empirische Studie über die Rolle der sozialen Herkunft und des institutionellen Kontexts für den Effekt von Familienkonstellationen auf Bildungschancen
Das Forschungsvorhaben untersucht inwiefern familiäre Instabilität zur Bildungsungleichheit in Deutschland und anderen europäischen Ländern beiträgt. Ziel des Projekts ist es, die Auswirkungen instabiler Familienkonstellationen auf die Bildungsübergänge in die Sekundar- und Tertiärstufe für Kinder unterschiedlicher sozialer Herkunft und in verschiedenen institutionellen Kontexten empirisch zu ermitteln. Im Rahmen des Projekts werden die Auswirkungen von durch die Trennung der Eltern erzeugte Instabilität für unterschiedliche soziale Schichten in Deutschland untersucht. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die zugrunde liegenden Mechanismen gelegt (z. B. Einkommensunsicherheit und Aspirationsfaktoren), die für die schichtspezifischen Konsequenzen der Bildungsübergänge der Kinder ausschlaggebend sind. Darüber hinaus befasst sich das Projekt mit der Bedeutung institutioneller Kontexte und wird insbesondere die Rolle von Sozialpolitik und die Ausgestaltung spezifischer Bildungssysteme bei der Verringerung negativer Auswirkungen alleinerziehender Elternschaft auf die Bildungsübergänge von Kindern in verschiedenen europäischen Ländern untersuchen. Die empirischen Analysen des Projektvorhabens basieren auf den Paneldaten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP), um die kausalen Effekte der Trennung der Eltern auf die Bildungsübergänge zu ermitteln, und auf EU-SILC-Paneldaten für 32 europäische Länder, um die Rolle institutioneller Kontexte zu untersuchen. Die statistische Analyse beruht auf Modellen für Langzeitdatensätze; im Besonderen auf dem Geschwister-basierten Sibling Fixed-Effects-Schätzers, Matching-Techniken und verschiedenen Spezifikationen von Mehrebenenmodellen.
Projektleitung: Kristina Lindemann, Ph.D.
Projektlaufzeit: 2020 - 2023
Digitale Entfremdung und Aneignung von Arbeit: Entfremdungserfahrungen in digitaler Dienstleistungsarbeit
Die Digitalisierung der Arbeitswelt kann als Treiber eines grundlegenden Strukturwandels der Arbeit verstanden werden. Dadurch stellen sich vielfältige Fragen nach der Zunahme von Fremdbestimmungen durch Algorithmen, Verlusten von Zeitautonomie, neuen Formen der Fragmentierung von Arbeit oder Veränderungen von sozialen Beziehungen. Um solche problematischen Entwicklungen zu beschreiben, wird im aktuellen Diskurs vereinzelt das Stichwort der Entfremdung genutzt. Der Nutzen eines solchen Konzepts im Kontext der digitalen Arbeit liegt in der Erforschung von Problemen, die über mögliche Autonomieverluste hinausgehen und Fragen wie einen Sinnverlust in der Arbeit sowie veränderte Selbstkonzeptionen beinhalten. Bisher beschränken sich die Ausführungen zum Begriff der Entfremdung meist auf sozialphilosophische Arbeiten. Eine empirische Analyse des Konzepts im Bereich der digitalen Arbeit fehlt weitgehend. Das Projekt schließt an dieses Desiderat an und widmet sich der Untersuchung digitaler Entfremdung. Untersucht werden Erfahrungen von Entfremdung und Aneignungsbemühungen von Arbeitnehmern auf verschiedenen Qualifikationsebenen in digitalen Arbeitsformen. Da die Entfremdung in der Vergangenheit vor allem in gering qualifizierten Bereichen der industriellen Arbeit untersucht wurde, ist über die Entfremdungspotenziale der digitalen Dienstleistungsarbeit wenig bekannt. Um diese Lücke zu schließen, untersucht das Projekt die digitale Dienstleistungsarbeit in etablierten Berufsfeldern und neuen Berufen der digitalen Ökonomie. Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines empirisch fundierten Konzepts digitaler Entfremdung in der Arbeit. Eine zentrale Frage ist, inwieweit die digitale Arbeit in verschiedenen Berufsgruppen des Dienstleistungssektors mit spezifischen Entfremdungserfahrungen einhergeht. Dies geschieht durch eine innovative Form des Zugangs zu subjektiven Entfremdungserfahrungen, die zwischen verschiedenen Ebenen von Entfremdungserfahrungen unterscheidet (biographisch, leiblich-emotional, praktisch- handelnd, kritisch-evaluativ). Ziel der Studie ist es, Einblicke in die Erfahrungen von Beschäftigten unterschiedlicher Qualifikationsebenen zu gewinnen und auf dieser Grundlage eine empirisch geerdete Definition digitaler Entfremdung zu entwickeln. Es wird ein qualitativer Forschungsansatz verwendet, bei dem Interviews und Gruppendiskussionen mit Beschäftigten in der Dienstleistungsarbeit durchgeführt werden. Untersucht werden hochqualifizierte, qualifizierte und gering qualifizierte Beschäftigte. Damit verbindet das Projekt theoretische, methodische und empirische Fragen der Entfremdungsforschung und zielt darauf ab, Entfremdung als Kategorie der Arbeitssoziologie zu rekonzipieren. Darüber hinaus werden verschiedene Ansätze zur Entfremdung aus der Soziologie, Psychologie und Philosophie einbezogen. Durch diese Verbindungen wird es möglich, das Konzept der Entfremdung für eine vielschichtige Beschreibung sozialer Probleme fruchtbar zu machen.
Projektleitung: Dr. Friedericke Hardering (an der GU)
Projektlaufzeit: Seit 2019
Doing Transitions. Formen der Gestaltung von Übergängen im Lebenslauf (DFG-Graduiertenkolleg)
Lebensverläufe sind durch eine Vielzahl von Übergängen strukturiert; sie vollziehen sich zwischen einzelnen Lebensphasen und Statuspositionen, zwischen unterschiedlichen Rollen und Selbstbildern. In der Vergangenheit interessierte sich die Forschung insbesondere für die Bedingungen, unter denen Übergänge erfolgreich verlaufen. Aus diesem Grund gerieten Übergänge – etwa der Wechsel von der Schule in den Arbeitsmarkt – häufig als Probleme in den Blick: Sie galten als unsicher und ungewiss, als Momente der Reproduktion sozialer Ungleichheit und als Risiken sozialen Ausschlusses. So unterschiedlich diese Studien sind, ihnen ist gemeinsam, dass Übergänge hier als natürliche Gegebenheiten erscheinen. Auch die damit verbundenen Normalitätsannahmen, die über Erfolg und Scheitern entscheiden, wurden kaum einmal problematisiert. Hier setzt das Graduiertenkolleg Doing Transitions ein und markiert einen Neuansatz. In das Zentrum rückt nun die Frage, worauf die unterschiedlichen Übergänge antworten, wie sie zustande kommen, wie sie gestaltet und dabei zugleich neu hergestellt werden. Zu diesem Zweck werden drei Ebenen der Gestaltung und der Herstellung von Übergängen quer zu den Lebensaltern untersucht. Um sowohl ihrer Eigenlogik wie auch den komplexen Wechselverhältnissen auf die Spur zu kommen, bearbeiten wir die folgenden Forschungsfragen:
- Diskurse: Wie werden Übergänge verhandelt? Von welchen Akteuren werden sie thematisiert? Welche Anforderungen des Wissens und Könnens an die Individuen werden dabei artikuliert? Wie werden Erfolg und Scheitern und diesbezügliche Risiken markiert?
- Institutionen: Wie werden Übergänge geregelt? Wie werden Übergänge durch formale und non-formale Markierungen, durch Abläufe, Verfahren und Akteure reguliert? Welche pädagogischen Aspekte der Vorbereitung, Überprüfung und Begleitung sind darin enthalten?
- Individuen: Wie werden Übergänge bewältigt? Wie entstehen Lebensentwürfe? Auf welche Weise werden Lebensentscheidungen getroffen und Lebensgeschichten bilanziert? Welche Lern- und Bildungsprozesse dokumentieren sich hier?
Projektleitung: Prof. Dr. Birgit Becker u.a.
Projektlaufzeit: Seit 2017
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity




