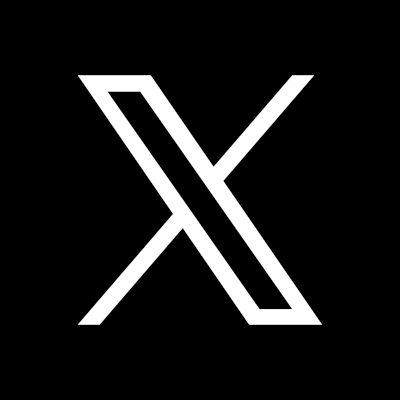Institutsnews – Dezember 2021
Ein Interview mit Katharina Hoppe über Angriffe auf Gender-Studies, das verzerrte Bild von der "Cancel-Culture" und die machtvolle Pose der Neutralität
"Forschung passiert nie losgelöst von Machtverhältnissen und auch nicht von Geschlechterverhältnissen"
Als Follow-Up zu ihren Beiträgen in der aktuellen Debatte um Wissenschaftsfreiheit hat Katharina Hoppe in Der Standard ein Interview zur sogenannten Cancel Culture und Machtverhältnissen an Universitäten gegeben.
Der Standard: Die Debatte über eine sogenannte Cancel-Culture an den Universitäten kocht immer wieder hoch: Personen mit unliebsamer Meinung würden von links attackiert, ihre Karrieren ruiniert. Ist das ein realistisches Bild?
Katharina Hoppe: Es gibt mit Sicherheit einzelne Fälle, die man diskutieren sollte. Dennoch schießt die Cancel-Culture-Debatte weit übers Ziel hinaus. Jede Rücktrittsforderung wird skandalisiert, tatsächlich passieren Rücktritte an der Universität in den seltensten Fällen. Im Grunde ist der Begriff der Cancel-Culture zu einem Kampfbegriff mutiert, der stark von rechts vereinnahmt wurde. Es geht darum, eine Bedrohung von links heraufzubeschwören, einzelne Fälle werden tendenziös überdehnt und existierende Machtverhältnisse schlicht ausgeblendet. Wenn eine schwarze Autorin, wie kürzlich Jasmina Kuhnke, ihren Besuch auf der Frankfurter Buchmesse absagt, weil sie sich von der Präsenz klar rechts positionierter Verlage bedroht fühlt, wird dies nicht als Cancel-Culture bezeichnet, sondern schlimmstenfalls als übertriebene Selbstzensur. Außerdem scheint auch niemand auf die Idee zu kommen, die Academics for Peace, die in der Türkei verfolgt und eingesperrt werden, als "gecancelt" zu bezeichnen.
Der Philosoph Konrad Paul Liessmann geht so weit, einen Fall vermeintlicher Cancel-Culture mit Wissenschaftsfeindlichkeit zu vergleichen, wie sie in der Pandemie passiert.
Pandemieleugnung und das Ringen um möglichst gute Wissensproduktion und damit auch um Wahrheit an Universitäten in einen Topf zu werfen, finde ich ein starkes Stück. Das Phänomen taucht aber immer wieder in der Debatte auf: Jede Form der wissenschaftlichen Arbeit, die Ungleichheiten thematisiert – zum Beispiel in der Geschlechterforschung oder auch der Migrationsforschung –, kann als Ideologie gebrandmarkt werden. Was Liessmann letztlich sagt: Die persönliche Betroffenheit hat gewonnen gegen die wissenschaftliche Objektivität. Ich denke, hier handelt es sich auch um einen Abwehrreflex gegen die Infragestellung von bisher sehr einflussreichen, machtvollen Positionen. Herrschaftskritischen Forschungen wird dann schlichtweg die Wissenschaftlichkeit abgesprochen.
Der Vorwurf, Ideologie statt wissenschaftliche Wahrheiten zu produzieren, begleitet die Gender-Studies von Beginn an.
Ja, es ist allerdings nicht so, als würden sich die Gender-Studies nicht selbst über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik verständigen. Es gibt immer schon eine lebendige Debatte darum, wie dieses Verhältnis sinnvoll zu bestimmen ist und wie man sich methodisch ausrichtet, um gesellschaftliche Verhältnisse angemessen darzustellen. Wenn den Gender-Studies Unwissenschaftlichkeit oder ideologische Verblendung vorgeworfen wird, ist es erst einmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass Wissenschaftskritik ein zentraler Bestandteil der Geschlechterforschung ist. Sie hat nichts mit Wissenschaftsfeindlichkeit zu tun, vielmehr hat Wissenschaftskritik in der Philosophie und in den Sozialwissenschaften insgesamt einen hohen Stellenwert. Wir stellen ja immer schon die Frage, was wir überhaupt erkennen können. Wo liegen die Voraussetzungen, die Begrenzungen und Möglichkeiten unseres Erkennens? Historisch betrachtet waren nicht alle Subjektpositionen gleichermaßen an der Wissensproduktion beteiligt. Die feministische und postkoloniale Wissenschaftsforschung hat gezeigt, dass sowohl Frauen als auch rassifizierte Personen lange von der wissenschaftlichen Wissensproduktion ausgeschlossen waren, weil ihnen Spezialinteressen zugeschrieben wurden, die nicht der Allgemeinheit dienen könnten.
Es geht also um Machtverhältnisse in der Forschung?
Forschung passiert nie losgelöst von sozialen Machtverhältnissen und auch nicht von Geschlechterverhältnissen. Jede Wissenschaft ist in historisches Geschehen involviert – und damit auch in irgendeiner Weise positioniert. Eine der wichtigsten politischen Positionen war immer schon die Pose der Neutralität: eine Maske, die behauptet, man hätte mit dem Geschehen rundherum nichts zu tun, man könnte die Welt objektivieren, ohne selbst darin vorzukommen. Die Frage dabei ist, wer eine solche Neutralität behaupten kann – und da ist feministische Kritik ganz zentral. Auch Liessmann fordert ja eine rationale Wissensproduktion in der Tradition der Aufklärung, die keinen Ort, keine Zeit und keinen Körper kennt. Hier werden marginalisierte Perspektiven zu moralischen oder ideologischen Perspektiven, denn sie können es sich nicht leisten, keine Position zu haben, werden als 'gebiast' markiert und ausgeschlossen. Die feministische Wissenschaftskritik legt den Finger in die Wunde – und das tut weh. Denn sie stellt damit die Neutralitätsbehauptung vieler etablierter Professor*innen infrage.
Sie fordern gemeinsam mit Kolleg*innen ein emanzipatorisches Verständnis von Wissenschaftsfreiheit ein – was ist damit gemeint?
Mit einer emanzipatorischen Idee von Wissenschaftsfreiheit wollen wir den Blick stärker auf strukturelle Machtverhältnisse lenken. Die Debatte um Cancel-Culture verkennt, wie die Institution Universität funktioniert. Universitäten sind stark hierarchisch organisiert, das heißt, viele marginalisierte Stimmen finden nach wie vor keinen Eingang in die wissenschaftliche Debatte. Diesen Ausschlüssen versuchen wir uns zu stellen und ihnen entgegenzutreten, wo es möglich und nötig ist. Es geht also darum, sie auch zum Gegenstand der Forschung zu machen, aber auch die Ansprüche auf Partizipation und Repräsentation marginalisierter Gruppen zu verteidigen. Das halte ich für besonders wichtig. Möglichst viele Perspektiven einzubeziehen kann zu einer besseren Darstellung der Welt beitragen – und damit auch zu einer robusteren Objektivität.
Das Interview wurde geführt von Brigitte Theißl und erschien am 16.12.2021 in Der Standard.
Dr. Katharina Hoppe ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Goethe Universität Frankfurt.
Weitere Beiträge zur Debatte um Wissenschaftsfreiheit:
- Machtverhältnisse statt Mythen. Für ein emanzipatorisches Verständnis von Wissenschaftsfreiheit
- Lars Meier (2021): Eine soziologische Unschärferelation. Replik zum Aufsatz "Is Free Speech in Danger on University Campus? Some Preliminary Evidence from a Most Likely Case" von Matthias Revers und Richard Traunmüller. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (2021) 73: 129-135.
- Grenzen der Meinungsfreiheit, Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit? Ein Streitgespräch mit Richard Traunmüller und Thomas Scheffer
Ein Debattenbeitrag von Katharina Hoppe et al.
Machtverhältnisse statt Mythen. Für ein emanzipatorisches Verständnis von Wissenschaftsfreiheit
(Queer-)feministische und anti-rassistische Positionen treffen derzeit auf den Vorwurf, sie würden die Wissenschaftsfreiheit gefährden. Doch dieser vermeintlichen Freiheitsbedrohung liegt eine selektive, politisch motivierte Dramatisierung von Einzelfällen zugrunde, die Machtasymmetrien ausblendet. Ein emanzipatorisches Verständnis von Wissenschaftsfreiheit führt zu einer anderen Lageeinschätzung.
Von Robin Celikates, Katharina Hoppe, Daniel Loick, Martin Nonhoff, Eva von Redecker, Frieder Vogelmann
Seit Monaten geistern Schlagworte wie „Cancel Culture“, „Political Correctness“ und „Wokeism“ durch das deutsche Feuilleton: Die drei Phänomene, so heißt es regelmäßig, würden zunehmend die öffentliche Debatte prägen. Alle drei diskursiven Marker dienen auch dazu, eine Bedrohung der akademischen Wissenschaftsfreiheit von links heraufzubeschwören. Zuletzt hatte insbesondere der Fall der britischen Philosophin Kathleen Stock Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Diese war in Sussex nach Protesten und einer teils gewaltsam entgleisten Social-Media-Kampagne queerer Aktivist:innen gegen die von ihr vertretenen transfeindlichen Positionen von ihrer Professur zurückgetreten. Nur wenige Tage nach ihrem Rücktritt wurde bekannt, dass sie nunmehr als Fellow an die neu gegründete University of Austin berufen wurde, die explizit einen Ort des „Anti-Wokism“ schaffen will.
Gegen diesen Missbrauch von „Wissenschaftsfreiheit“ hielten und halten wir Kritik für dringend geboten. Wir sind ein Autor:innenkollektiv aus Mitgliedern des Frankfurter Arbeitskreises für politische Theorie und Philosophie, einem Zusammenschluss von Geistes- und Sozialwissenschaftler:innen, die sich im Kontext der neueren kritischen Theorie verorten. In dem Beitrag „Wissenschaftsfreiheit, die wir meinen“ (Zeit v. 18.11.2021) hatten wir vor dem oben skizzierten Hintergrund für ein emanzipatorisches Verständnis von Wissenschaftsfreiheit plädiert, das von der selektiven Fokussierung auf und politischen Instrumentalisierung von Einzelfällen Abstand nimmt und besonders auf die Analyse und Infragestellung der universitären Machtverhältnisse abhebt. Die Universität ist historisch ein von Asymmetrien und Ausschlüssen durchzogener Ort, so unser Argument, an dem marginalisierte Stimmen häufig keinen Eingang in den wissenschaftlichen Diskurs finden. Gegen diese Hierarchien zu kämpfen, ist daher ein Eintreten für (wohlverstandene) Wissenschaftsfreiheit, keine Bedrohung derselben.
Ironischerweise sind es weder Vermittlungs- noch Überzeugungsstrategien, mit denen der angeblichen Bedrohung von links begegnet wird. Die reflexartigen Erwiderungen verlassen rasch die sachliche Ebene zugunsten von Unterstellungen und persönlichen Angriffen. Oder sie gehen gleich dazu über, Schweigegebote auszusprechen, wie sie etwa Uwe Steinhoff auf seiner Homepage und auf Twitter an die Adresse von Paula-Irene Villa richtete. Auch unser Beitrag hat wütende Reaktionen hervorgerufen. Die Repliken „Was man nicht kritisieren darf“ von Uwe Steinhoff (FAZ v. 22.11.2021) und „Gezielte Kampagnen“ von Vojin Saša Vukadinović (Zeit v. 25.11.2021) bringen die Debatte auf genau jenes Niveau der Diskussion dramatischer Einzelfälle, auf dem sich sowohl die Wissenschaftsfreiheit als auch ihre tatsächlichen Gefährdungen schnell verzerrt darstellen – und einfacher verzerren lassen. Solche Verzerrungen folgen einem Muster, das drei rhetorische Strategien kombiniert, die im Kampf gegen die vermeintliche „Cancel Culture“ besonders beliebt sind: die Dramatisierung von Einzelfällen, den Vorwurf der Täter-Opfer-Umkehr und die Verbreitung widerlegter Mythen.
Erstens ist es für die anti-woken Verteidiger:innen der Debattenkultur typisch, apodiktisch zu konstatieren, die Wissenschaftsfreiheit sei besonders durch „Transaktivisten oder Gender-Studies-Personal“ gefährdet. Es folgt – z.B. bei Vukadinović – die Aufzählung einer Reihe von Fällen in Großbritannien und die Formulierung des Vorwurfs, die andere Seite erwähne „nichts, was dort in den letzten Jahren eine zentrale Rolle spielte“. Das geht gleich doppelt an der Debatte vorbei: Niemand leugnet die Existenz oder die Relevanz dieser Fälle, doch diese bedürfen einer Einordnung in die universitären und gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Dann jedoch müsste man außerdem eine Reihe von Fällen berücksichtigen, die Vukadinović unterschlägt, weil sie das gängige und von ihm reproduzierte Narrativ in Frage stellen, die akademische Freiheit werde vor allem durch trans- und andere woke social justice warriors gefährdet. Denn er verliert kein Wort zu Lisa Tilley, die im August ihre Stelle am Birkbeck College in London aufgab, um auf die Bedrohung der akademischen Freiheit durch ihren Kollegen, den bekannten Rechtsintellektuellen Eric Kaufmann, aufmerksam zu machen, der gezielt von ihm als links identifizierte Studierende und Kolleg:innen attackiert; kein Wort zu der von Sara Ahmed dokumentierten Tatsache, dass Beschwerden über Machtmissbrauch von Kolleg:innen, Vorgesetzten und Universitätsleitungen oft unter den Teppich gekehrt und unter Androhung von Vergeltung aktiv unterbunden werden, wenn Angehörige von Minderheiten oder in der institutionellen Hierarchie schlechter Gestellte sie äußern; kein Wort dazu, dass (aus Sicht der NGO Liberty und des Joint Committee on Human Rights) die Meinungsfreiheit an den Universitäten in Großbritannien vor allem durch die Prevent Agenda der Regierung gefährdet ist, da besonders BAME (Black, Asian, and minority ethnic) Studierende schnell des Extremismus verdächtigt werden, wenn sie „zu radikale“ Ansichten vertreten, und daher zur Selbstzensur gedrängt werden; kein Wort schließlich dazu, dass auch in Großbritannien, wie in Frankreich und in den USA, regelmäßig insbesondere Forschung zu Rassismus von der Regierung als unwissenschaftlich attackiert wird. Alles nur „projektive Problematisierungen“? Beiträge wie jener von Vukadinović führen genau jene selektive Dramatisierung von Einzelfällen vor, an der die Debatte insgesamt krankt: ein spezieller Fall wird als repräsentativ für die gesamte Lage behauptet, ohne zu untersuchen, welche realen Machtverhältnissen diese Lage bereits strukturieren.
Zweitens läuft auch der Vorwurf der Täter-Opfer-Umkehr ins Leere. Eigentlich sollte es keiner weiteren Erläuterung bedürfen, dass der Hinweis auf die Kritikwürdigkeit einer ganzen Reihe dokumentierter Aussagen von Stock und auf die Einseitigkeit der medialen Berichterstattung über ihren Fall keine Rechtfertigung von Morddrohungen darstellt. Der Kampf „mit allen Mitteln“ ist eine rechte Strategie, die außerhalb der Wissenschaft ganz genauso zu kritisieren ist wie innerhalb. Auch emanzipatorisch angelegter Aktivismus kann in Bedrohungen umschlagen, insbesondere wenn er mit auf Social Media-Plattformen geführten Kampagnen einhergeht. Sachlich formulierte offene Briefe und begründete Proteste sind demgegenüber nicht nur legitime Mittel des Protests, sondern Herzstück demokratischer Willensbildung, und zwar im Kontext des Streits um politische Stellungnahmen – wie diejenigen von Stock in Sachen Rechte von Trans-Personen – auch innerhalb von Universitäten. Diese Strategien mit hate tweets, Einschüchterungsversuchen und gar Morddrohungen in einen Topf zu werfen, ist eine unlautere Strategie, berechtigte Kritik zu delegitimieren.
Differenzierungen sind allerdings nicht die Sache Vukadinovićs, was angesichts seiner früheren Attacken auf das Werk von Judith Butler und „die Gender Studies“ nicht überrascht. Trotz der an anderer Stelle (etwa von Sabine Hark und Judith Butler sowie von Paula-Irene Villa) bereits mit starken Gründen eingeforderten Nuancen schreibt Vukadinović – ebenso wie auch Stock in ihrem Buch Material Girls – weiterhin gegen einen Popanz an: „die Gender Studies“ und ihre „postmoderne“ Leugnung der Realität. Schon die Behauptung, Autor:innen wie Foucault und Butler würden die Realität leugnen, ist absurd; die Fiktion einer einheitlichen Position in „den Gender Studies“ zum Thema Geschlecht und Geschlechteridentität schlicht unwissenschaftlich. Wie vielschichtig und kontrovers die entsprechenden Debatten tatsächlich sind, kann man sich schnell vor Augen führen, wenn man die entsprechenden Zeitschriften (z.B. Feministische Studien oder Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy) und die einschlägigen Beiträge in Online-Enzyklopädien (z.B. https://plato.stanford.edu/entries/feminism-gender/ oder https://plato.stanford.edu/entries/feminism-trans/) konsultiert. Diese für wissenschaftliche Debatten typische Komplexität kommt bei Stock und Vukadinović an keiner Stelle vor. Sie fordern zwar Respekt für ihre vermeintlich rein wissenschaftlichen Einlassungen, lassen aber ein Mindestmaß an wissenschaftlicher Seriosität vermissen und ignorieren willentlich, dass man die relevanten theoretischen Fragen auch diskutieren kann, ohne Menschen die Legitimität ihrer Geschlechtsidentitäten und ihres Anspruchs auf ein Leben ohne Angst vor Gewalt abzusprechen. Das legt nahe, dass es ihnen tatsächlich um etwas anderes geht als einen Beitrag zur akademischen Diskussion: nämlich um die Verunmöglichung von Kritik und die Durchsetzung einer transfeindlichen politischen Agenda unter dem Deckmantel der Wissenschaftsfreiheit (die zudem, immer wenn es strategisch opportun erscheint, mit der Meinungsfreiheit gleichgesetzt wird, obwohl sie klarerweise anderen Standards und Logiken folgt). Damit stellen sie sich selbst in die Nähe derjenigen, die auf ebenso schwacher Grundlage „LGBT-Ideologiefreie Zonen“ fordern und Butler für die Verkörperung des Teufels halten.
Menschenrechtsorganisationen sowie LGBTQ*-Initiativen weisen seit langer Zeit darauf hin, dass Transpersonen gravierenden Anfeindungen und Übergriffen im Alltag, Diskriminierungen im Beruf und Benachteiligungen im öffentlichen Leben ausgesetzt sind. Gestützt werden diese Ausschlüsse, die massives physisches und psychosoziales Leid bewirken, etwa durch Vorurteile, Hassideologien und kulturell dominante Narrative. Diese Erfahrungen – und dies ist die dritte rhetorische Strategie – werden bagatellisiert, wenn Transfeindlichkeit einfach als eine wissenschaftliche „Meinung“ unter anderen dargestellt wird – wie es etwa Uwe Steinhoff tut, der zugleich offen ausspricht, was viele nur denken, nämlich dass vulnerable Personen ohnehin „an einer Universität fehl am Platze“ seien. Vukadinović geht einen Schritt weiter und bedient selbst transfeindliche Vorurteile, indem er empirisch widerlegte Mythen kolportiert, die belegen sollen, dass von trans Personen sowohl als Campus-Aktivist:innen als auch im Alltag eine so große Gefahr ausgehe, dass wir ihre Geschlechtsidentität nicht anerkennen sollten. Nur so ist seine den Anschein empirischer Evidenz erschleichende Behauptung zu verstehen, dass aufgrund der Rechte von trans Personen nun Frauen „noch im Gefängnis Risiko laufen, vergewaltigt zu werden“. Hier wird ein Feindbild beschworen, das Sexualpanik auslösen soll. Die Fantasie geht auf einen einzigen Fall zurück, einen folgenschweren Justizskandal, im Zuge dessen ein wegen Vergewaltigung verurteilter Häftling in ein britisches Frauengefängnis verlegt wurde. (Die gravierende und grassierende sexualisierte Gewalt, der trans Frauen in Männergefängnissen ausgesetzt sind, kommt selbstverständlich nicht zur Sprache). Damit soll die Furcht verbreitet werden, dass unter dem Deckmantel der Transsexualität gewalttätige Männer in Frauenräume eindringen – neben Gefängnissen werden häufig Toiletten genannt. Doch diese Argumentation ist absurd: Nirgends sonst nehmen wir eine ganze Gruppe in Haftung, um der Möglichkeit eines gewaltsamen Übergriffs vorzubeugen. So wird sexualisierte Gewalt überwiegend von Männern in Familien und auf der Straße verübt – trotzdem dürfen Männer Familien haben und vor die Tür. Dass Gewalt aber überwiegend von Männern ausgeht, verweist genau auf die Ebene struktureller Machtverhältnisse. Das Problem geschlechtsspezifischer Gewalt muss durch feministische, gesamtgesellschaftliche Reformen angegangen werden. Sobald der Gegner Patriarchat heißt und nicht „Transgender-Ideologie“ ist es allerdings schwer, Beifall von einer breiten Querfront zu bekommen.
Steinhoffs und Vukadinovićs Texte zeigen wie im Lehrstück, wie unter Bezugnahme auf „Wissenschaftsfreiheit“ asymmetrische Machtverhältnisse verschleiert werden, die Forschung und Lehre durchziehen: Ein rein formaler Begriff von Wissenschaftsfreiheit, der weder nach den zugrundeliegenden Ausschlussverhältnissen noch nach den potenziell gewaltförmigen Konsequenzen von Forschung fragt, reproduziert bestehende Machtverhältnisse – und schließt damit echte Wissenschaftsfreiheit aus. Die Pose der „Neutralität“ ermöglicht es dominanten Gruppen, handfeste politische Interessen als „unvoreingenommene“ oder „rationale“ Forschungsergebnisse zu präsentieren und gleichzeitig marginalisierte politische Interessen als „moralistisch“ oder „ideologisch“ (so Steinhoff) zu disqualifizieren. Selten liegen die politischen Interessen so offen auf der Hand wie bei den deutschen Anhänger:innen von Kathleen Stock, die sich aktuell vor allem gegen die von der Ampel-Koalition geplante Liberalisierung des Personenstandsgesetzes richten (so etwa Steinhoff im rechtskonservativen Magazin Cicero). Häufig geht es um viel subtilere – ökonomische, kulturelle und habituelle – Ausschlüsse. Wer an echter Wissenschaftsfreiheit interessiert ist, muss diese Ungleichheiten angehen: Denn ohne vormals ausgeschlossene Perspektiven einzubeziehen, läuft der wissenschaftliche Diskurs nicht nur Gefahr, soziale Herrschaftsverhältnisse zu reproduzieren, sondern auch die Wissensproduktion künstlich einzuschränken und sich Wege zu einer robusteren Objektivität zu verbauen.
Den Blick auf die strukturelle Ebene zu richten, heißt nicht, bestimmten Gruppen a priori Recht zu geben. Oft heißt es sogar, Gruppenzuschreibungen zu historisieren und zu problematisieren (also Identitätspolitik zu kritisieren). Ebenso wichtig ist es, immer wieder neu danach zu fragen, wo sich auch in ehemals marginalisierten Positionen neue Macht- und Gewaltverhältnisse herausbilden können. Es ist hingegen hochproblematisch von der Gewalt, die Stock entgegenschlug, auf die allgemeinen Verhältnisse kurzzuschließen. Auch wenn jeder Einzelfall zählt, sind Versuche moralischer Panikmache, die sich weder auf die empirische Bedrohungslage noch auf die in der philosophischen Debatte vertretenen Positionen stützen können, Hindernisse für eine ernsthafte Debatte über die Bedrohungen von Wissenschaftsfreiheit. Ein emanzipatorisches Verständnis von Wissenschaftsfreiheit bedarf – und fördert! – klare Machtanalysen, keine weitere Verbreitung von Mythen.
Dr. Katharina Hoppe ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt.
Robin Celikates ist Professor für Sozialphilosophie an der Freien Universität Berlin.
Daniel Loick ist Associate Professor für Politische Philosophie und Sozialphilosophie an der Universität Amsterdam.
Martin Nonhoff unterrichtet Politische Theorie an der Universität Bremen.
Eva von Redecker ist Philosophin und forscht derzeit als Marie-Skłodowska-Curie-Fellow an der Universität Verona.
Frieder Vogelmann lehrt Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie an der Albert Ludwigs-Universität Freiburg.
Der Beitrag erschien erstmals am 08. Dezember bei geschichte der gegenwart.
Weitere Beiträge zur Debatte um Wissenschaftsfreiheit:
- "Forschung passiert nie losgelöst von Machtverhältnissen und auch nicht von Geschlechterverhältnissen." Ein Interview mit Katharina Hoppe über Angriffe auf Gender-Studies, das verzerrte Bild von der "Cancel-Culture" und die machtvolle Pose der Neutralität
- Lars Meier (2021): Eine soziologische Unschärferelation.
Replik zum Aufsatz "Is Free Speech in Danger on University Campus? Some Preliminary Evidence from a Most Likely Case" von Matthias Revers und Richard Traunmüller. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (2021) 73: 129-135. - Grenzen der Meinungsfreiheit, Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit? Ein Streitgespräch mit Richard Traunmüller und Thomas Scheffer
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity