Monografien
The Government of Things
Foucault and the New Materialisms
Materialism, a rich philosophical tradition that goes back to antiquity, is currently undergoing a renaissance. In The Government of Things,
Thomas Lemke provides a comprehensive overview and critical assessment
of this “new materialism”. In analyzing the work of Graham Harman, Jane
Bennett, and Karen Barad, Lemke articulates what, exactly, new
materialism is and how it has evolved. These insights open up new spaces
for critical thought and political experimentation, overcoming the
limits of anthropocentrism.
Drawing on Michel Foucault’s concept
of a “government of things”, the book also goes beyond new materialist
scholarship which tends to displace political questions by ethical and
aesthetic concerns. It puts forward a relational and performative
account of materialities that more closely attends to the interplay of
epistemological, ontological, and political issues.
Lemke
provides definitive and much-needed clarity about the fascinating
potential—and limitations—of new materialism as a whole. The Government of Things revisits
Foucault’s more-than-human understanding of government to capture a new
constellation of power: “environmentality”. As the book demonstrates,
contemporary modes of government seek to control the social, ecological,
and technological conditions of life rather than directly targeting
individuals and populations. The book offers an essential and much
needed tool to critically examine this political shift.
Thomas Lemke: The Government of Things. Foucault and the New Materialisms. New York: NYU Press 2021.
Neue Materialismen zur Einführung

Katharina Hoppe und Thomas Lemke
Seit etwa zwanzig Jahren findet in den Kultur- und Sozialwissenschaften eine wichtige Akzentverschiebung statt: Materialitäten, Objekte und Artefakte erfahren zunehmend wissenschaftliche Aufmerksamkeit und werden neu konzeptualisiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die sogenannten Neuen Materialismen, die das dynamische Zusammenspiel von Bedeutungsprozessen und materiellen Gefügen untersuchen. Dieser Einführungsband bietet erstmals einen Überblick über zentrale Debattenstränge dieser Forschungsperspektive. Er stellt wichtige Vertreter_innen des Neomaterialismus wie Jane Bennett, Karen Barad, Rosi Braidotti und Donna Haraway vor und zeigt dessen Innovationspotenzial ebenso auf wie analytische Inkonsistenzen und konzeptuelle Leerstellen
Lemke, T. & Hoppe, K. (2021). Neue Materialismen zur Einführung, Hamburg: Junius Verlag.
Reproduktion und Selektion
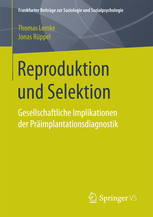
Gesellschaftliche Implikationen der Präimplantationsdiagnostik
Thomas Lemke und Jonas Rüppel rekonstruieren den sozialwissenschaftlichen Forschungsstand zu gesellschaftlichen Implikationen der Präimplantationsdiagnostik (PID) und identifizieren u.a. folgende Problemkomplexe: eine Expansion der PID in neue Anwendungsfelder, eine Verfestigung sozialer Ungleichheiten sowie einen Wandel normativer Erwartungen hin zur Vorstellung einer genetischen Reproduktionsverantwortung. Diese konvergiert mit einer individualisierenden Präventionslogik, die gegenwärtige Transformationsprozesse der Medizin und Gesundheitspolitik kennzeichnet.
Lemke, T. & Rüppel, J. (2017). Reproduktion und Selektion. Gesellschaftliche Implikationen der Präimplantationsdiagnostik, Wiesbaden: Springer VS.
Perspectives on Genetic Discrimination

Over the past 15 years, a series of empirical studies in different countries have shown that our increasing genetic knowledge leads to new forms of exclusion, disadvantaging and stigmatization. The spectrum of this "genetic discrimination" ranges from disadvantages at work, via problems with insurance policies, to difficulties with adoption agencies.
The empirical studies on the problem of genetic discrimination have not gone unnoticed. Since the beginning of the 1990s, a series of legislative initiatives and statements, both on the national level and on the part of international and supranational organizations and commissions, have been put forward as ways of protecting people from genetic discrimination.
This is the first book to critically evaluate the empirical evidence and the theoretical usefulness of the concept of "genetic discrimination." It discusses the advantages and limitations of adopting the concept, and offers a more complex account distinguishing between several dimensions and forms of genetic discrimination.
Lemke, T. (2013). Perspectives on Genetic Discrimination, New York/London: Routledge.
Die Natur in der Soziologie
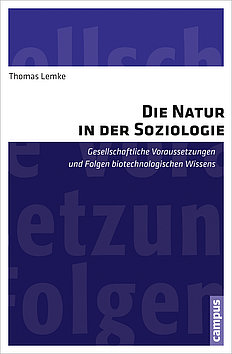
Gesellschaftliche Voraussetzungen und Folgen biotechnologischen Wissens
In den vergangenen Jahren haben sozialwissenschaftliche Analysen der Voraussetzungen und Folgen biowissenschaftlichen Wissen und biotechnologischer Innovationen große Resonanz erfahren.
Die »Social Studies of Biomedicine and Biotechnologies« sind mittlerweile ein äußerst produktiver und schnell wachsender Forschungszweig – allerdings nicht in Deutschland. Hierzulande werden diese Fragen bislang nur ansatzweise empirisch untersucht und theoretisch reflektiert.
An dieser Forschungslücke setzt der Band von Thomas Lemke an. Er macht die internationale Diskussion für die deutschsprachigen Sozialwissenschaften zugänglich und nimmt eine eigenständige Positionierung innerhalb des Forschungsfelds vor. Lemke zeigt, dass eine Neuorientierung in der Soziologie erforderlich ist, die einen anderen Naturbegriff und ein Überdenken der disziplinären Arbeitsteilung zwischen Sozial- und Naturwissenschaften beinhaltet.
Lemke, T. (2013). Die Natur in der Soziologie. Gesellschaftliche Voraussetzungen und Folgen biotechnologischen Wissens, Frankfurt am Main/New York: Campus.
Foucault, Governmentality, and Critique
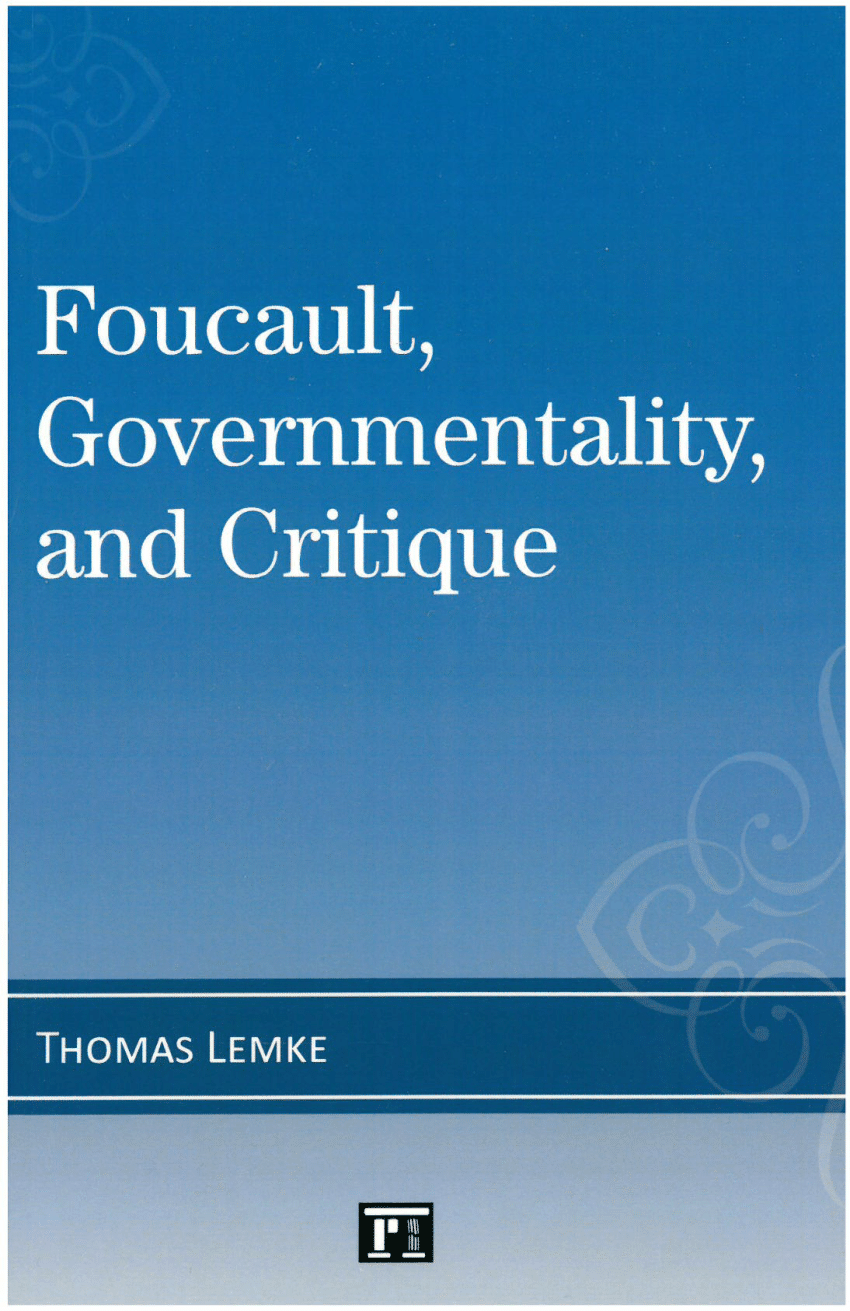
Michel Foucault is one of the most cited authors in social science. This book discusses one of his most influential concepts: governmentality. Reconstructing its emergence in Foucault's analytics of power, the book explores the theoretical strengths the concept of governmentality offers for political analysis and critique.
It highlights the intimate link between neoliberal rationalities and the problem of biopolitics including issues around genetic and reproductive technologies. This book is a useful introduction to Foucault's work on power and governmentality suitable for experts and students alike.
Lemke, T. (2011). Foucault, Governmentality, and Critique, Boulder, CO/London: Paradigm Publishers.
Übersetzungen in andere Sprachen
- Lemke, T. (2015). Türkische Übersetzung: Foucault, Yönetimsellik ve Devlet, übersetzt von Utku Özmakas, Ankara: Pharmakon.
- Lemke, T. (2017). Portugiesische Übersetzung: Foucault, Governamentalidade e Crítica, übersetzt von Eduardo A. Camargo Santos und Mario Marino, São Paulo: Editora Politeia.
Der medizinische Blick in die Zukunft
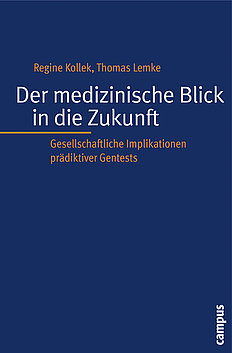
Gesellschaftliche Implikationen prädiktiver Gentests
Genetische Tests gehören heute zum medizinischen Alltag. Einer ihrer brisanten Einsatzbereiche ist die prädiktive Diagnostik, die das Risiko zukünftiger Erkrankungen bei bislang gesunden Menschen ermittelt.
Dieses Buch beleuchtet die entscheidenden Veränderungen, die der genetische Blick in die Zukunft bringt: Neben besseren Heilungschancen für viele Krankheiten gehört hierzu auch ein anderer kollektiver Umgang mit Behinderung, Krankheit und Tod.
Kollek, R. & Lemke, T. (2008). Der medizinische Blick in die Zukunft. Gesellschaftliche Implikationen prädiktiver Gentests, Frankfurt am Main/New York: Campus.
Gouvernementalität und Biopolitik

»Vergesst Foucault!« – so lautete die provokante Aufforderung Jean Baudrillards Ende der 1970er Jahre. Ein Vierteljahrhundert später ist die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Werk des französischen Historikers und Philosophen intensiver denn je.
Zwei Konzepte haben in den vergangenen Jahren die Rezeption in besonderer Weise geprägt: Gouvernementalität und Biopolitik.
Der vorliegende Band erkundet die gegenwartsdiagnostische Reichweite und die soziologische Relevanz der beiden Konzepte. Er zeichnet ihre Entstehungskontexte und Bedeutungsdimensionen nach und diskutiert Perspektiven und Probleme der aktuellen Rezeption. Das Ergebnis ist eine theoretische Weiterentwicklung der Machtanalytik, die sich auf empirische Forschungsfragen bezieht und ihr gesellschaftskritisches Potenzial aufzeigt.
Lemke, T. (12007, 22008). Gouvernementalität und Biopolitik, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Biopolitik zur Einführung

Der Begriff der Biopolitik ist in aller Munde. Das Spektrum seiner Verwendungsweisen reicht von der Asyl-Politik über die AIDS-Prävention bis hin zur Bekämpfung des Bevölkerungswachstums. Er bezeichnet die Unterstützung landwirtschaftlicher Produkte ebenso wie die Förderung medizinischer Forschung, strafrechtliche Bestimmungen zur Abtreibung und Patientenverfügungen zum Lebensende.
Von »Biopolitik« reden Vertreter der Neuen Rechten ebenso wie linke Globalisierungsgegner, Kritiker des biotechnologischen Fortschritts, aber auch dessen Befürworter.
Dieser Band bringt Klarheit in das begriffliche Wirrwarr. Er liefert einen Überblick über die Geschichte des Begriffs und erläutert seine Bedeutung in aktuellen politischen Auseinandersetzungen und gesellschaftstheoretischen Debatten. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Arbeiten des französischen Philosophen Michel Foucault und die an seinen Begriff der Biopolitik anschließenden Theorien von Giorgio Agamben auf der einen und Michael Hardt und Antonio Negri auf der anderen Seite.
Lemke, T. (12007, 22013). Biopolitik zur Einführung, Hamburg: Junius Verlag.
Übersetzungen in andere Sprachen
- Lemke, T. (2009). Dänische Übersetzung: Biopolitik. En introduktion, übersetzt von Lars Christiansen, Kopenhagen: Hans Reitzel Forlag.
- Lemke, T. (2010). Polnische Übersetzung: Biopolityka, übersetzt von Tomasz Dominiak, Warschau: Wdawnictwo Sic!.
- Lemke, T. (2011). Englische Übersetzung: Biopolitics. An Advanced Introduction, übersetzt von Eric Frederick Trump, New York/London: New York University Press.
- Lemke, T. (2013). Türkische Übersetzung: Biyopolitika, übersetzt von Utku Özmakas, Istanbul: Iletişim.
- Lemke, T. (2015). Koreanische Übersetzung: What is Biopolitics? Übersetzt von Sung-bo Shim, Seoul: Greenbee.
- Lemke, T. (2017). Spanische Übersetzung: Introducción a la biopolitica, übersetzt von Lidia Tirado Zedillo, Mexico City: Fondo de Cultura Económica.
- Lemke, T. (2017). Persische Übersetzung: Biopolitics: An Advanced Introduction, übersetzt von Mastaneh Farnam. Teheran: Rowzaneh Publishing House.
- Lemke, T. (2018). Portugiesische Übersetzung: Biopolitíca: críticas, debates e perspectivas, übersetzt von Eduardo A. Camargo Santos, São Paulo: Editora Politeia.
Die Polizei der Gene
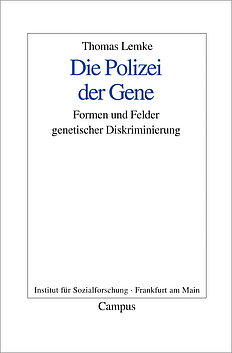
Formen und Felder genetischer Diskriminierung
»Warum sollte man nicht von einer genetischen Inquisition träumen?«, schrieb Georges Canguilhem schon 1966. Thomas Lemke zeigt anschaulich, dass dieser Traum inzwischen teilweise Realität geworden ist. Er erläutert, wie die aus genetischen Untersuchungen gewonnenen Informationen zu Ausgrenzung und Stigmatisierung führen.
Das Spektrum reicht von Benachteiligungen im Arbeitsleben über Probleme mit Versicherungen bis zu verweigerten Adoptionen. Aber auch die wissenschaftliche Kritik an genetischer Diskriminierung beruht, wie Lemke verdeutlicht, häufig auf der Vorstellung, dass Gene die menschliche Existenz fundamental prägen und den Kern der Persönlichkeit ausmachen.
Lemke, T. (2006). Die Polizei der Gene. Formen und Felder genetischer Diskriminierung, Frankfurt am Main/New York: Campus.
Dossier: Marx et Foucault
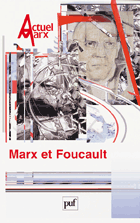
Giacomelli, M. E., Jessop, B., Le Blanc, G., Legrand, S., Lemke, T. & Montag, W. (2004). Dossier: Marx et Foucault. Actuel Marx 36.
Übersetzungen in andere Sprachen
- Lemke et al. (2006). Spanische Übersetzung: Marx y Foucault, übersetzt von Heber Cardoso und Elena Marengo, Buenos Aires: Nueva Visión.
- Lemke et al. (2007). Chinesische Übersetzung: Makesi yu Fuke, übersetzt von Yuan Chen, Shanghai: East China Normal University Press.
Veranlagung und Verantwortung
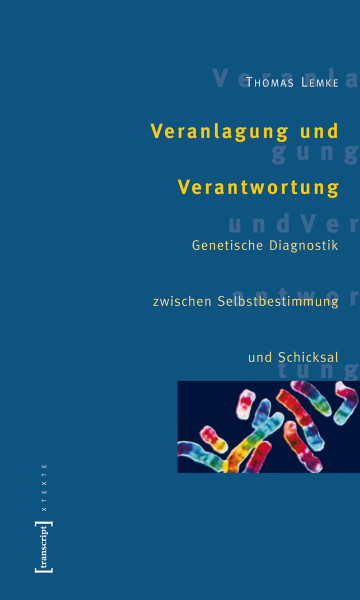
Genetische Diagnostik zwischen Selbstbestimmung und Schicksal
Sind Gene unser Schicksal? Die sozialwissenschaftliche und philosophische Diskussion der Ergebnisse der Genomforschung ist eigentümlich verzerrt. Meist wird die Gefahr eines genetischen Determinismus beschworen, der Selbstbestimmung und Freiheit der Subjekte bedrohe. Diese Studie zeigt die Grenzen dieser Kritik.
Sie macht deutlich, dass die Arbeit von Selbsthilfegruppen im Bereich genetischer Krankheiten neue Formen personaler Identität und kollektiver Vergemeinschaftung schafft. Das genetische Wissen führt nicht zu einer »Biologisierung des Sozialen«, sondern verändert die individuelle Erfahrung von Schwangerschaft, Familie und Partnerschaft ebenso grundlegend wie gesellschaftliche Institutionen.
Lemke, T. (2004). Veranlagung und Verantwortung. Genetische Diagnostik zwischen Selbstbestimmung und Schicksal, Bielefeld: transcript Verlag.
Organisation in der modernen Gesellschaft

Eine historische Einführung
Der Band bietet eine Einführung in die Genese und Entfaltung moderner Organisation von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Organisation wird dabei als ein historisch spezifisches Verhältnis und als ein strategisches Element für die Konstitution, Etablierung und Reproduktion asymmetrischer gesellschaftlicher Strukturen begriffen. Die Autoren tragen damit dazu bei, die erheblichen historischen Lücken in der organisationswissenschaftlichen Literatur zu schließen; sie streben darüber hinaus eine organisationssoziologische Erweiterung der Gesellschaftstheorie an.Bruch, M., Lemke, T. & Türk, K. (12002, 22006). Organisation in der modernen Gesellschaft. Eine historische Einführung, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Eine Kritik der politischen Vernunft
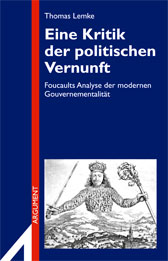
Foucaults Analyse der modernen Gouvernementalität
Die Analyse der Gouvernementalität, die Foucault vor allem in den weitgehend unveröffentlichten Vorlesungen am Collège de France entwickelt, weist auf den inneren Zusammenhang zwischen der »Genealogie des modernen Staates« und der »Genealogie des modernen Subjekts« hin. Damit gelingt es Foucault, die engen Beziehungen zwischen »Bio-Politik« und Rassismus, Freiheit und Sicherheit, dem Abbau sozialstaatlicher Leistungen und dem zunehmenden Appell an »Eigenverantwortung« und »Selbstsorge« aufzuzeigen. Der Neoliberalismus ist demnach eine politische Rationalität, die nicht nur eine neue Form des Sozialen erfindet, sondern auch eine neue (»autonome«) Subjektivität. In ihr sind wirtschaftlicher Wohlstand und persönliches Wohlsein miteinander gekoppelt, wobei nicht nur der individuelle Körper, sondern auch der Staat als politischer Körper »schlank« und »fit« sein muss.Lemke, T. (11997, 21998, 32002, 42003, 52011). Eine Kritik der politischen Vernunft – Foucaults Analyse der modernen Gouvernementalität, Hamburg/Berlin: Argument.
Übersetzungen in andere Sprachen
- Lemke, T. (2016). Türkische Übersetzung: Politik Aklın Eleştirisi: Foucault'nun Modern Yönetimsellik Çözümlemesi, übersetzt von Özge Karlik, Ankara: Phoenix Publisher.
- Lemke, T. (2019). Englische Übersetzung: A Critique of Political Reason. Foucault’s Analysis of Modern Governmentality, London: Verso.
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity





