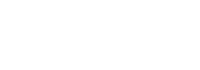The last section describes social policy reforms and reform coalitions. Despite neo-liberal tendencies during the 90s and early 2000s, there have been areas of expansion within welfare state policy in the last 15 to 20 years, in particular for social investments. The authors also discuss recent research findings demonstrating a stronger consensus between unions and employer associations with regard to social investments.
In addition to this discussion see one of the latest articles published by Benedikt Bender doi.org/10.1017/S0047279422000873
ZSR 2024; 70(2):145-172
Benedikt Bender und Laura Malsch
Politische Konflikte in der Sozialpolitik zwischen 2017–2021 in Deutschland: Eine Inhaltsanalyse von Plenardokumenten und Pressemitteilungen
Aus der Zeitschrift für Sozialreformhttps://doi.org/10.1515/zsr-2023-0019
Zusammenfassung Die Studie erweitert die Forschung zur Unterstützung sozialpolitischer Reformen bei Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Wir zeigen, dass kompensatorische Maßnahmen die klassischen Konflikte zwischen rechts und links sowie Arbeit und Kapital widerspiegeln. Sozialinvestitionen zeigen hingegen klassenübergreifende Befürwortung; außer bei der AfD, die sich gegen eine breite Unterstützung zu Gleichstellungsmaßnahmen am Arbeitsplatz positioniert. Die Ergebnisse basieren auf einer systematisch qualitativen Inhaltsanalyse von 21 Plenarprotokollen und 323 Pressemitteilungen zwischen 2017 und 2021
(19. Legislaturperiode). Der Beitrag trägt zum einen dazu bei, die konzeptuelle Relevanz der Unterscheidung zwischen kompensatorischer und sozialinvestiver Sozialpolitik zu verdeutlichen. Zum anderen zeigen wir, dass es sich trotz unterschiedlicher Zielvorstellungen der Akteure bei den Sozialinvestitionen um ein überwiegend – wenn auch nicht völlig – konfliktfreies Politikfeld handelt. Dies trägt zur Erklärung des kontinuierlichen Ausbaus von Sozialinvestitionen bei und kann auch als Prognose für eine zukünftig, sozialinvestive Entwicklung in Deutschland betrachtet werden.
Bender, Benedikt and Malsch, Laura (2024): Politische Konflikte in der Sozialpolitik zwischen 2017–2021 in Deutschland: Eine Inhaltsanalyse von Plenardokumenten und Pressemitteilungen. Zeitschrift für Sozialreform, 70, 2, 145-172. https://doi.org/10.1515/zsr-2023-0019
We classified social compensation reforms in relation to de-commodification. There are four levels: (1) unemployment benefits, (2) minimum child-care allowance (against poverty) (3) minimum pension scheme (against poverty in old age) (4) other social benefits. Here we expect unreconcilable class conflict between different actors. We classified social investment reforms in relation to the creation, mobilization, and preservation of human capital: (1) child care service (2) incentives for female employment, (3) gender equality at work, (4) active labor market policies. Here we expect cross-class alliances since these reforms are compatible with the different motivational perspectives amongst actors.
We selected Germany because it is a late comer in the expansion of social investments. However, the fast shift towards more social investment in the last 15 years is unique within Europe. We argue that this is rooted in cross-class consensus for social investment reforms despite motivational differences. We use systematic content analysis of the minutes of 21 parliamentary plenary sessions and 323 press releases (2017-2021). All political parties were represented in the German Bundestag, the national trade union organization (DGB) as well as the national employer association (BDA).

As expected, we show classic conflict between left and right, and between labour and capital regarding social compensation. Left-wing actors (Linke, SPD, Grüne) support the expansion of social compensations, whilst conservative (CDU/CSU), liberal (FDP) and right-wing populist (AfD) parties oppose them. For social compensation there is no cross-class consensus because different motivations lead to conflicting positions on social policy.


To understand social policy positions, we need to distinguish between social compensation and investment, since different patterns of conflict and overlapping interests are possible. There is more potential for overlapping interests amongst actors with regard to social investment measures. This leads us to expect an expansion of such reforms in the near future. Due to new fiscal constraints in an increasingly crisis-ridden world, government need to set clear priorities for social policy reform and ensure that all actors are motivated to support them.
Abschluss von ProDem
Die konkreten Forschungsergebnisse wurden auf einer Reihe europäischer Fachkonferenzen präsentiert und können in einer Vielzahl an Publikationen nachgelesen werden. Im Jahr 2025 wird ein gemeinsamer Sammelband bei Routledge erscheinen.
Wir als Frankfurter Forschungsgruppe möchten zum Abschluss dieses Projekts dem gesamten Konsortium für die exzellente Zusammenarbeit sowie der VolkswagenStiftung für die großzügige Ermöglichung dieses wichtigen Forschungsprojekts sehr herzlich danken!
Ein Kolloquium neuen Typs - oder: wie man sich einem Riesen nähert
Das Studium gleicht einem Roadtrip: Es ist Freiheit und Abenteuer, eine Zeit voller unbegrenzter Möglichkeiten, Herausforderungen und Überraschungen. Man bricht auf ins Ungewisse, trifft neue Menschen – einige werden zu dauerhaften Weggefährt*innen, andere verliert man unterwegs wieder aus den Augen. Fast jede*r erlebt während des Studiums Höhen und Tiefen, Herausforderungen und Erfolgserlebnisse. Man entwickelt sich persönlich und intellektuell von der*m Schüler*in zur*m Akademiker*in.
Gegen Ende dieser Reise lernen viele Studierende Herrn Tur Tur kennen - wenn sich als letzter Schritt des Studiums die Abschlussarbeit abzeichnet. Doch wer ist dieser Herr Tur Tur?
In Michael Endes Kinderbuch "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" verirren sich die Protagonisten Jim und Lukas in der Wüste "Ende der Welt". Dort entdecken sie am Horizont eine riesige Gestalt. Jim ist verängstigt, doch als Lukas vorangeht, folgt er ihm. Als sie der Gestalt näherkommen, erweist sich der "Riese" als ein Mann von ganz normaler Größe, der sich als "Herr Tur Tur" vorstellt. Lukas erklärt Jim, Herr Tur Tur sei nichts anderes als ein „Scheinriese“.
Herr Tur Tur steht also sinnbildlich für die Abschlussarbeit. Das Durchqueren der Wüste für den letzten Schritt am Ende des Studiums. Glücklicherweise sind die Studierenden an diesem Punkt nicht allein. Ihre "Reisegruppe" ist das Kolloquium.
In diesem Kontext ist das Kolloquium neuen Typs von Professor Wagemann zu verstehen. Anders als herkömmliche Kolloquien liegt der Schwerpunkt hier nicht auf der Präsentation und Diskussion eines Exposés. Es setzt viel früher an und soll die Studierenden beim Durchqueren der „Wüste“ Abschlussarbeit – von der Themensuche bis hin zu einem realistischen Exposé - begleiten.
Dieser Prozess gliedert sich in zwei klare Schritte: Zunächst denken die Studierenden in angeleiteten Gruppen über das Erkenntnisinteresse nach und erarbeiten die Forschungsfrage, zu der sie eine Forschungsskizze erstellen. Neben der Ausarbeitung der inhaltlichen Frage, geht es auch um praktische Hilfestellungen wie das Zeitmanagement und Hinweise zu den zu verwendenden Methoden und der Literaturarbeit. Im zweiten Schritt wandeln die Kolloquiums-Teilnehmer*innen ihre Proto-Exposés in machbare Entwürfe für eine Abschlussarbeit um. Hierbei passt die Gruppe den Zeitplan an und entwickelt Schreibstrategien. Mehrere Zwischenschritte und Feedback-Schleifen vervollständigen die Veranstaltung. Der Schwerpunkt dieses Kolloquium liegt also eindeutig in der Gruppen- und Teamarbeit, einschließlich der Zusammenarbeit mit Dozierenden und Tutor*innen. Wesentliche Schritte im Arbeitsprozess werden gemeinsam erarbeitet. Man nähert sich Herrn Tur Tur nicht alleine, sondern als Team.
So ist es nicht verwunderlich, dass sich unser Kolloquium bei den Studierenden großer Beliebtheit erfreut. Nach dem ersten Durchlauf im neuen Stil hat uns nicht nur das sehr gute Evaluationsergebnis gezeigt, dass wir einen Nerv getroffen haben. Auch die Anmeldezahlen sind inzwischen in jedem Semester so hoch, dass wir die Zahl inzwischen auf 30 Teilnehmer*innen deckeln mussten. Wenn auch nicht alle Interessierten einen der begehrten Plätze erhalten, so hoffen wir doch, dass sich das ein oder andere aus der Veranstaltung als Best Practice auch über unser Kolloquium hinaus im Fachbereich etabliert.
E LA NAVE VA - Buch zum Vigoni-Workshop erschienen
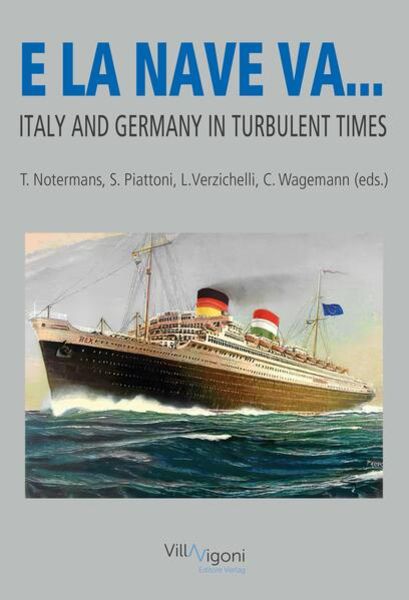
Wohin aber die Reise geht, und ob das Schiff seetauglich ist, das hat eine internationale Wissenschaftler*innengruppe aus Italien und Deutschland im Herbst 2021 diskutiert, darunter auch eine größere Gruppe von unserer Professur samt Professor Wagemann als Co-Organisator des Workshops in enger Zusammenarbeit mit der Villa Vigoni. Die verschiedenen Beiträge, vor allem von Nachwuchswissenschaftler*innen, sind mittlerweile in Buchform erschienen, unter der Herausgeberschaft von Claudius Wagemann und seinen Kolleg*innen Ton Notermans, Simona Piattoni und Luca Verzichelli. Frankfurter Beiträge stammen von Lukas Brenner, Nikolaus Freimuth, Alexander Mathewes, Mohamed Salhi und Nils Sartorius.
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity